Ukraine: Verlorene Heimat
- von Jessica Socher
Zerstörte Karrieren, zerrissene Familien, Zukunftsangst. Ein Krieg in der Ostukraine – mitten in Europa. Vier Geschichten.
„Stellt euch vor, ihr lebt und es ist alles fest. Ihr habt Pläne, eine Arbeit und Familie. Ihr baut euer Leben auf – ihr plant es. Und dann kommt der Punkt, an dem ihr alles verliert. Alles was ihr hattet. Der Krieg hat unser komplettes Leben verändert und man kann es nicht mehr zurückholen.“ Natalja
Seit 2014 herrscht Krieg in der Ostukraine. Niemand dachte damals, dass sich die Situation immer weiter zuspitzen und bis heute andauern würde. In der Alltagssprache wird mittlerweile oft von Krieg oder Konflikt gesprochen – manchmal auch von Bürgerkrieg. Russland hingegen hat beispielsweise Interesse daran, es als internen Konflikt darzustellen. Inzwischen sind Teile der Gebiete Luhansk und Donezk von prorussischen Separatisten besetzt, die sich von der Ukraine abgrenzen wollen. Die ukrainische Regierung hat diese Regionen nicht mehr unter Kontrolle.

An der Front stehen sich ukrainische Soldaten und prorussische Separatisten mit russischer Unterstützung gegenüber. Bis Ende 2018 sind in diesem Konflikt etwa 13 000 Menschen getötet und circa 30 000 verletzt worden. Diese Zahlen veröffentlichten die Vereinten Nationen (UN). Es trifft Zivilisten und Soldaten auf beiden Seiten. Die genaue politische Lage ist unklar. Das UN-Flüchtlingskommissariat erklärte am 28. Juli 2014 für die Gebiete Luhansk und Donezk den totalen Zusammenbruch von Recht und Ordnung – Freiheitsberaubung, Entführung, Folter und Exekution. Aus den besetzten Gebieten dringen kaum Informationen nach außen. Eine freie Berichterstattung ist nicht möglich. Vier Menschen erzählen Einsteins, wie sich ihr Leben durch den Krieg verändert hat.

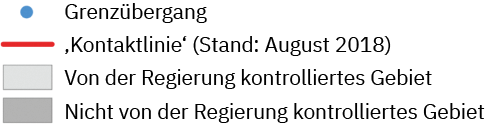



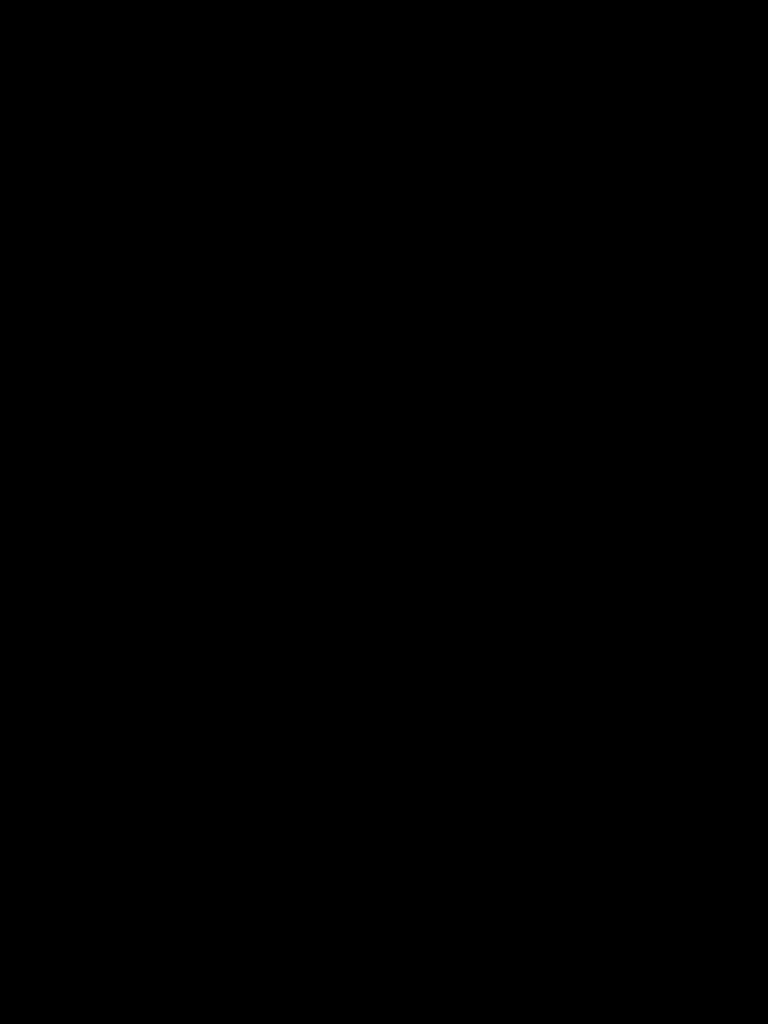
Von außen wirkt Symon (24) wie ein schüchterner junger Mann. Fängt er an zu sprechen, überrascht er mit einer lauten, kräftigen Stimme. Symon interessiert sich für Geschichte, da kennt er sich aus. Auch seinen Bachelor hat er in diesem Fach gemacht. Bis Symon 19 Jahre alt war, lebte er mit seiner Familie in Donezk. Wie sich seine Heimatstadt zwischen 2013 und 2014 veränderte, bekam er hautnah mit.
Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 traf die Ukraine besonders stark. Das Wirtschaftswachstum brach ein, die Exporte gingen zurück, die Arbeitslosigkeit stieg an. Andere Länder erholten sich, die Ukraine nicht. Symon erzählt, dass die Stimmung 2013 in Donezk sehr schlecht war. Wirtschaftlich ging es den Menschen nicht gut. In den Haushaltswarenläden seiner Eltern kaufte kaum noch jemand ein. Seine Familie hoffte, wie viele andere auch, auf ein Abkommen mit der Europäischen Union (EU), das der damalige Präsident Wiktor Janukowytsch im Herbst unterschreiben wollte. Doch der russische Präsident Wladimir Putin drohte der Ukraine mit Handelsnachteilen. Die Folge: Janukowytsch unterschrieb das Abkommen nicht.
„Wir müssen etwas machen, wir müssen protestieren. Wenn wir nicht protestieren, werden wir immer in diesem schlechten Zustand bleiben.“ An die Worte seines Onkels kann sich Symon noch gut erinnern. Und so geht seine Familie auf die Straße und protestiert. Seine Mutter, von Beruf Künstlerin, stellt ein selbstgemaltes Bild vor dem Regierungsgebäude auf – das Wappen der Ukraine, umkreist von den EU-Sternen. Auch Symon verteilt in seiner Universität blaue Aufkleber mit gelben Sternen, darauf steht: „Wir existieren.“ Konsequenzen gibt es für Symon nicht. „In der Universität war das nicht so streng, da konnte man seine Meinung noch frei äußern. Auf der Straße dagegen musste man vorsichtig sein“, sagt er.
Das spüren auch seine Eltern. Die Proteste vor den Regierungsgebäuden werden immer gewaltsamer. Viele Menschen werden mit Steinen und Messern verletzt und landen im Krankenhaus. Wegen einer ukrainischen Flagge, die Symons Eltern am Auto hängen haben, werden die Fenster eingeschlagen. „Zu dieser Zeit sind auch Panzer eingefahren“, erinnert sich Symon. Das ist das erste Mal, dass Symon bemerkt, wie ernst die Lage wirklich ist. Und auch seine Eltern werden vorsichtiger, nehmen die Flagge vom Auto. „Sonst wäre das Auto wieder kaputt gewesen, oder etwas noch Schlimmeres wäre passiert.“
Symon ist Jude. Deshalb bekommt er auch mit, wie in der jüdischen Gemeinde in Donezk Zettel verteilt werden. Darauf werden alle Juden aufgefordert, sich in Donezk bei der Regierung, die unter der Kontrolle von prorussischen Separatisten steht, registrieren zu lassen. Warum, weiß Symon nicht, aber er fand es „unheimlich, weil das wie in der Nazi-Zeit war“.
Im Sommer 2014 hofft Symon noch, dass alles wieder normal wird. Bis sein Großvater eines Tages vom Markt zurückkommt und erzählt, dass die ganze Stadt voller Soldaten sei. Die Familie beschließt endgültig zu gehen. Symon verlässt seine Heimat mit einem mulmigen Gefühl. „Überall in der Stadt waren Menschen mit Waffen und am Hauptbahnhof stand ein Mann mit militärischer Kleidung und hat Kriegslieder gesungen – das war ein bisschen unheimlich.“
Zwei Jahre lang wohnte seine Familie bei Verwandten in Dnipro, ungefähr sechs Autostunden von ihrer früheren Heimat entfernt. „Mir ging es nicht so schlecht dort, aber meinen Eltern. Denn sie hatten keine Arbeit und auch keine Zukunft dort.“ Die früheren Geschäfte seiner Eltern konnten aufgrund des Krieges und der Armut in Donezk nicht verkauft werden.
2016 stellten Symons Eltern einen Antrag in der deutschen Botschaft, um nach Deutschland zu dürfen. Sie wollten sich eine neue Zukunft aufbauen und sahen ihre Chance in Deutschland. Seit 2017 wohnt Symon mit seinen Eltern, seinem jüngeren Bruder und seinen Großeltern in Baden-Württemberg. Er hat sich gut eingelebt, kann sich aber vorstellen, zurück in die Ukraine zu gehen. Allerdings nicht zurück in seine Heimatstadt Donezk. „Ich denke, die Stadt ist ohne Zukunft.“



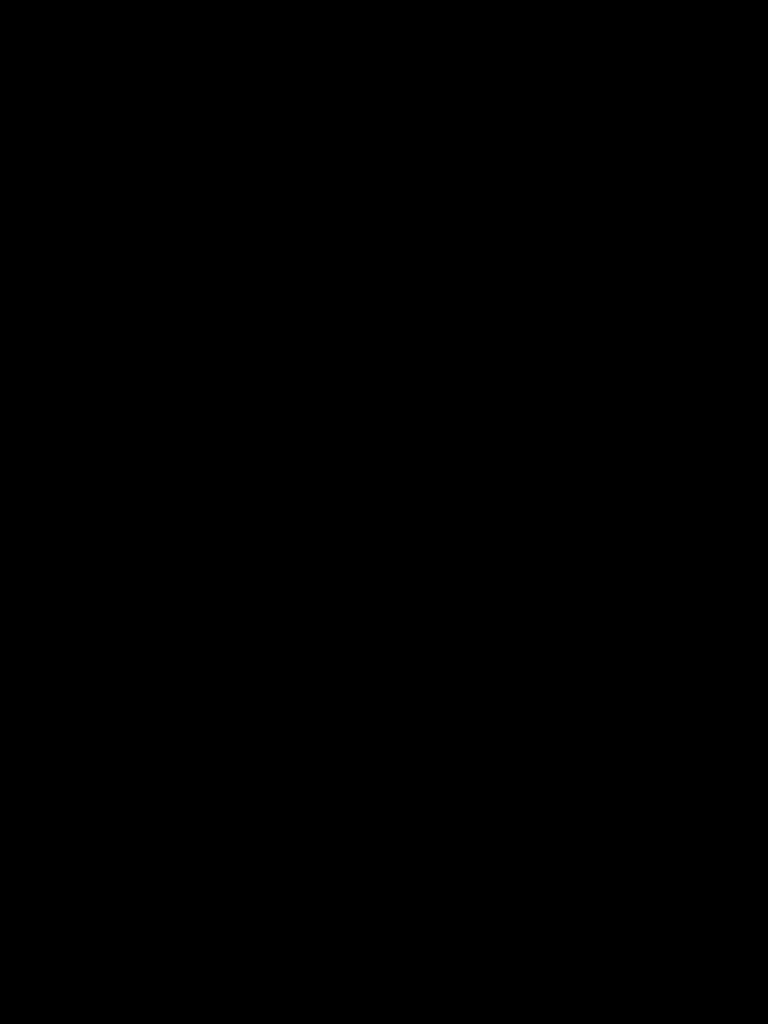
Auch Olena (36) sieht für sich keine Zukunft in der Stadt Donezk. Anders als Symon konnte sie sich auf ihren Umzug aber nicht vorbereiten. Denn als sie ihre Heimatstadt Donezk verließ, ahnte sie nicht, dass sie so schnell nicht mehr zurückkommen würde.
Sommer 2014. Olena hat frei und möchte ihren Mann besuchen. Er kommt auch aus der Ostukraine, studiert aber gerade in Deutschland. Olena ist 31 Jahre alt und steht am Anfang ihrer Karriere. Sie unterrichtet an einer Universität in Donezk, liebt ihren Job und ihre Kollegen. „Ich war genau an meinem Platz“, erzählt Olena. Umso härter trifft sie bei ihrem Besuch in Deutschland die Nachricht, dass bewaffnete Soldaten in Donezk einmarschiert sind. Ihre Eltern und Freunde raten ihr davon ab, zurückzukommen. Seither war sie nicht mehr in Donezk, sie hat alles dort gelassen: Ihre Karriere, ihre Freunde und für sie am Schlimmsten: ihre Eltern. „Es ist zu gefährlich. Wenn ich hingehe, komme ich vielleicht nicht wieder“, sagt sie.
„Was passiert nun mit mir?“, fragt sich Olena in dieser Zeit. Ein Problem folgt dem nächsten. Nach ein paar Wochen läuft ihr Touristenvisum ab und sie reist zurück in die Ukraine. Um weiter in Deutschland leben zu dürfen, muss sie eine Sprachprüfung bestehen. Sie zieht für einige Wochen zurück – allerdings in die Mitte der Ukraine nach Kiew. Dort wohnt sie in einem Hotel und lernt ununterbrochen Deutsch. „Angebot und Rabatt waren bis dahin die einzigen deutschen Wörter, die ich kannte.“ Auch wenn sie jetzt darüber lachen kann, erinnert sie sich gut daran, wie schlimm die Situation für sie war, weil ihre Karriere so schlagartig vorbei war. „Für mich bin ich keine Hausfrau.“ In Deutschland war sie das aber. Gezwungenermaßen. Jetzt, nach fünf Jahren, hat sie zwar einen Job, kann sich aber nicht vorstellen, in ihren alten Beruf zurückzukehren. „Ich bin Perfektionistin. Das Sprachniveau, um an einer Universität zu unterrichten, werde ich niemals haben.“ Trotzdem ist Olena froh, dass sie durch ihren Mann nach Deutschland kommen konnte. Am liebsten hätte sie auch ihre Eltern hier, aber die können die Großmutter in Donezk nicht allein lassen.
Olena plagen Schuldgefühle. Schuldgefühle, weil sie in Sicherheit ist, aber ihre Familie und ihre Freunde nicht. Im ersten Jahr quält sie sich damit, sich rund um die Uhr über die Ereignisse in Donezk zu informieren. Sie möchte ihren Freunden und ihrer Familie dadurch nah sein. „Meine Freunde erzählen immer, wie viel Angst sie haben und ich kann nie sagen: Ja, ich weiß, wie das ist“.
Um die Psyche ihrer Eltern sorgt sie sich am meisten. Vor allem im ersten Jahr sind ununterbrochen Bomben nahe dem Haus ihrer Eltern abgeworfen worden. Zeitweise kann Olenas Mutter das Haus gar nicht verlassen, weil es draußen zu gefährlich ist. Ihre Mutter hat stark abgenommen. Olena glaubt, das liege an der ständigen Anspannung. Sie erklärt: „Eine Bombe kann jede Minute einschlagen. Jede Sekunde weißt du nicht, ob du weiterlebst oder nicht.“ Olena erzählt auch, dass sich ihre Mutter so an das Pfeifen der Bomben gewöhnt hat, dass sie mittlerweile mehr Angst hat, wenn es mal still ist.
Olena hat ihre Eltern, seit sie Donezk 2014 verlassen hat, nicht mehr besucht. Um in das Gebiet zu kommen, müsste sie eine bewachte Grenze überqueren. Auf beiden Seiten der Grenze stehen bewaffnete Soldaten. „Es ist tödlich da. Es kann alles passieren, es gibt keine Gesetze.“ Sie ist immer noch fassungslos, wenn sie an das denkt, was in ihrer Stadt alles passiert ist. Zum Beispiel das Referendum in Donezk, das 2014 klären sollte, ob Teile der Ostukraine unabhängig werden wollten. Die Wahl lief alles andere als fair ab: mehrfache Stimmabgaben, bewaffnete Wahlbeobachter, vage Abstimmungsfrage. Das Referendum, das auf keiner Rechtsgrundlage basierte, wurde international nicht anerkannt. Olena hat sich bei der Wahl enthalten. Danach hat sie ihre Freunde und Familie gefragt, was sie auf dem Zettel angegeben hätten. „Keiner hat verstanden, worum es ging. Jeder von ihnen hat mir etwas anderes erzählt, was dort als Frage überhaupt gestellt wurde.“
Für Olena ist ihre Heimatstadt nicht mehr ihre Heimatstadt. So zu fühlen und das zu sagen, ist ihr peinlich. „Die Stadt ist zerstört und die Leute da sind Fremde“, sagt sie. Im Moment will sie nicht zurück in die Ukraine. Deutschland bedeutet für Olena Zukunft und Sicherheit. All das, was ihr Donezk nicht mehr bieten kann.



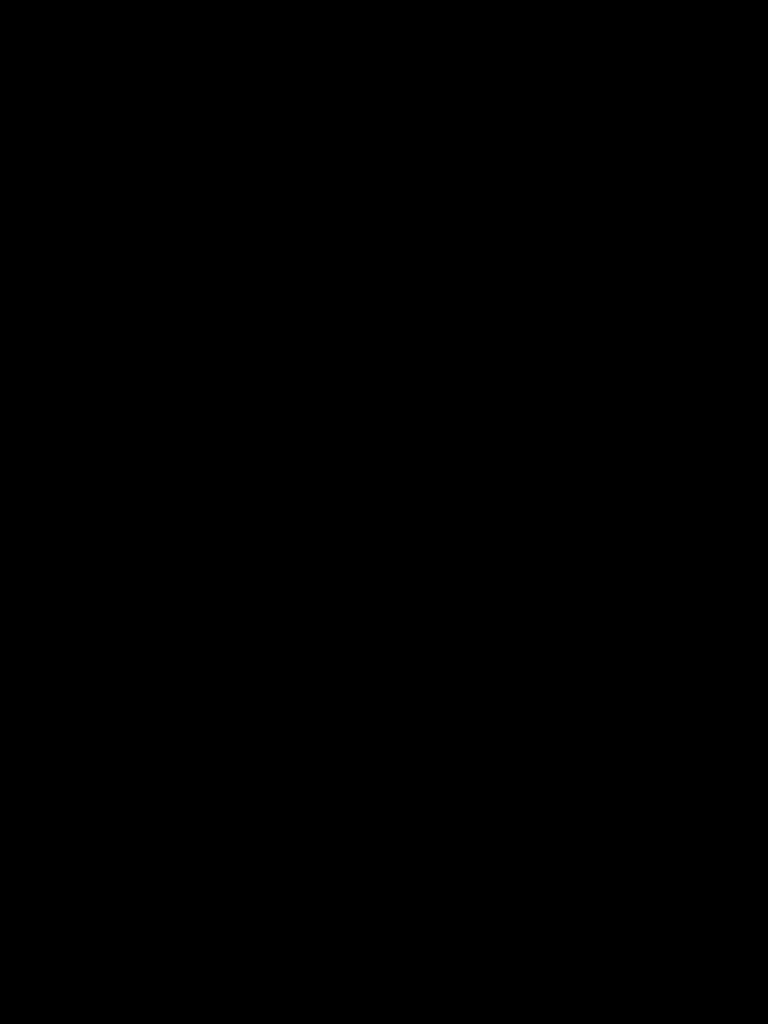
Ihor (27) aus Lwiw war 2014 gerade einmal 22 Jahre alt und mitten in seiner Ausbildung zum Priester im ruhigen, westlichen Teil der Ukraine. Zusammen mit Studienfreunden und anderen Freiwilligen hat er sich im Dezember vorgenommen, Weihnachten an die Front zu bringen. Die Gruppe ging von Haus zu Haus, führte die Weihnachtsgeschichte auf und sammelte dabei Spenden. Hauptsächlich Essen und warme Kleidung.
Denn die Ukraine war nicht bereit für den Krieg. „Wir waren wie Kanonenfutter“, sagt er. Das Land habe keine Armee gehabt, an der Front kämpften hauptsächlich Freiwillige. Den Umgang mit Waffen hätten sie nie gelernt. Viele, vor allem sehr junge Männer zwischen 18 und 22 Jahren, kämpften an der Front. „Und es war so kalt“, sagt Ihor. Er erzählt von den Soldaten in weißen Uniformen, die sie trugen, damit sie im Schnee nicht entdeckt werden konnten.
Die Soldaten wohnten in verlassenen Häusern und Erdlöchern. Wie in einer Art Bombenkeller. Dunkel und feucht. Bilder von den Soldaten, die er besuchte, hat Ihor nicht. Denn niemand wollte seine Identität preisgeben. „Das ist zu gefährlich für die Familien“, sagt er. In den Erdlöchern hätten die Soldaten viele Tiere gehabt. Sozusagen als Glücksbringer. Sie waren für die jungen Männer emotional sehr wichtig. Ihor hat die Katze „Granate“ kennengelernt. Die Tiere kamen zu ihnen, weil sie sonst keiner fütterte. Wenn plötzlich alle verschwanden, wussten die Soldaten, dass etwas Schlimmes passieren wird. Der Glaube daran gehe sogar so weit, dass die Männer eine gespendete Weihnachtsente nicht schlachten wollten. Laut Ihor waren sich alle einig: „Einen Talisman essen wir nicht.“
Bei dem Besuch an der Front hat Ihor nicht viel mit den Soldaten über den Krieg gesprochen. Doch er erzählt: „Man sieht ihnen an, dass sie viel weinen. Und sie trinken viel, sie wohnen einfach in der Erde.“ Ihor schüttelt den Kopf und schaut nach unten auf seine Hände. „Ich finde es schlimm“, sagt er, „wir sitzen zusammen, sprechen und essen mit diesen Menschen und am nächsten Tag kommt einer nicht mehr zurück und dann heißt es: Er wurde erschossen.“
Obwohl Ihor nur eine Woche an der Front unterwegs war, sagt er selbst, dass der Besuch sein Leben verändert habe. Für sein Studium lebt er mittlerweile in Deutschland. Den Krieg vergessen kann und will er aber nicht. Denn die Mütter, deren Söhne kämpfen, könnten den Krieg auch nicht einfach vergessen. Deshalb schaut er regelmäßig die ukrainischen Nachrichten. „Es tut weh, wenn du jeden Tag siehst, dass dein Volk kämpft und Leute sterben.“ In den deutschen Medien findet er dagegen kaum etwas zu dem Konflikt.
Erst vor ein paar Monaten sei ein Freund von ihm ums Leben gekommen. Er erinnert sich an einen Urlaub mit ihm am Meer und daran, wie viel Spaß sie hatten. „Und dann siehst du ein Foto von seinem Grab.“ Viele junge Menschen, die noch nichts von der Welt gesehen hätten, lägen jetzt im Grab, sagt Ihor. „Ihr habt das auch, aus dem Zweiten Weltkrieg – aber unsere Gräber sind frisch.“
Mittlerweile, nach fünf Jahren Krieg, ist die Ukraine besser darin geworden, einen Krieg zu führen. Sie haben eine Armee und aktuell werden keine neuen Gebiete mehr besetzt. Doch vor Kurzem hat Russland angefangen, in den besetzen Gebieten in der Ukraine russische Pässe zu verteilen. Darüber berichtete unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Diese erklärt in einem Artikel, dass so der „Schutz russischer Bürger“ als Vorwand für einen regulären Militäreinmarsch dienen könnte.
Schlimm ist für Ihor, dass die schrecklichen Nachrichten von Toten und Verletzten nicht aufhören. „Niemand braucht das“, sagt er. Wenn Ihor darüber spricht, liegt seine Stirn in Falten, seine Stimme wird lauter und seine Sätze kommen selten mit einem Punkt zum Ende. Für ihn ist das Schlimmste, dass er nichts dagegen tun kann und sonst auch keiner etwas macht: „Europa schweigt.“



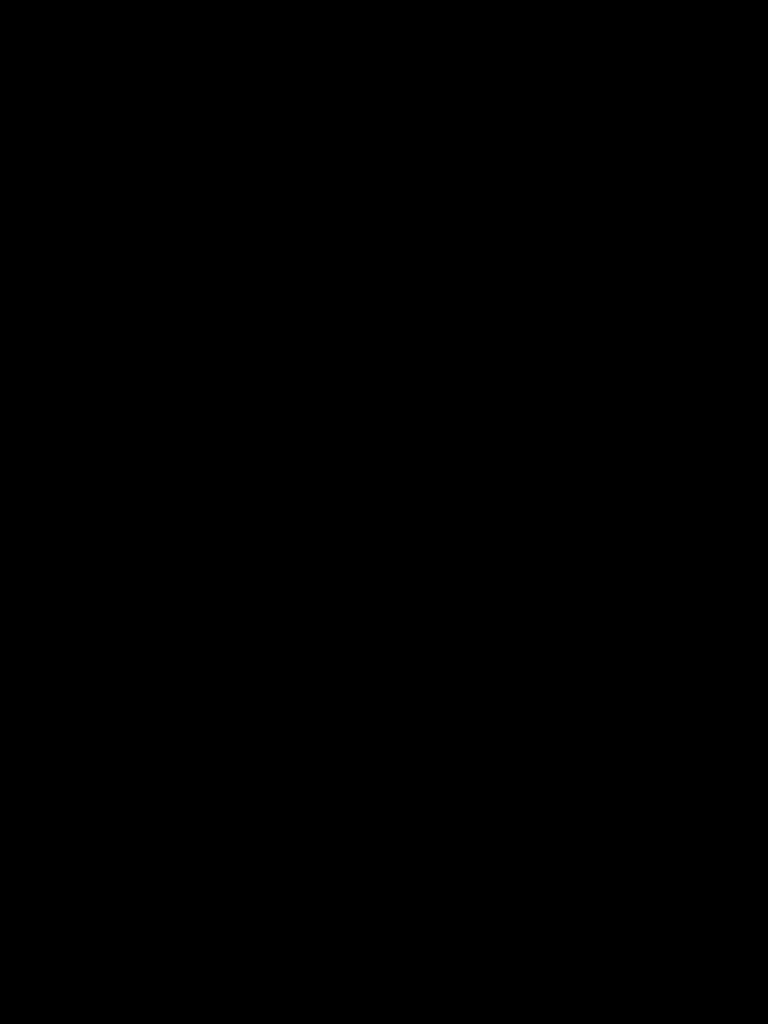
Natalja kommen die Tränen. Direkt bei der ersten Frage, direkt in der ersten Minute. Ihre Geschichte zu erzählen, fällt ihr nicht leicht. Ein Foto von sich möchte sie nicht machen lassen. Sie fühlt sich nicht sicher.
Natalja ist 41 Jahre alt und kommt aus Makejewka, einer Stadt im Donezk-Gebiet, die nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle ist. „Der Krieg hat ganz plötzlich angefangen“, sagt Natalja. Sie habe zunächst gar nicht verstanden, dass jetzt wirklich Krieg sei. Um sie herum sind die meisten Bewohner der Stadt geflüchtet. „Ich konnte nicht so einfach wegfahren, ich hatte ja ein Kind.“ Und so begann 2014 ihr Leben vor ihren Augen zusammenzubrechen.
Natalja unterrichtet damals an einer Universität Wirtschaft. Durch die Unruhen und die Besetzung in der Stadt muss die Universität erst schließen, später umziehen. So wie viele Universitäten, die in den umkämpften Gebieten liegen. Plötzlich steht sie ohne Job da. Sie muss eine Entscheidung treffen und beschließt, der Universität zu folgen. Sie zieht in ein kleines Zimmer im 85 Kilometer entfernten Pokrowsk, das unter ukrainischer Kontrolle steht. Ihren Sohn Nikola lässt sie bei den Großeltern. Sie will ihn nicht aus seiner gewohnten Heimat, weg von seinen Freunden und seiner Grundschule, reißen. Sie pendelt so oft es geht den langen Weg zwischen den beiden Städten hin und her. Dabei muss sie jedes Mal die stark bewachte Grenze zu dem besetzten Gebiet überqueren. „Viele sterben da, weil sie es körperlich nicht aushalten“, erzählt sie. Das passiere nicht jeden Tag, aber diese Grenze sei eine Qual. Sie erzählt, dass die Schlangen vor der Grenze so lang seien, dass es ohne eine Übernachtung nicht gehe. In den Schlangen müssen die Menschen zu Fuß anstehen, mit dem Auto können sie nicht durch. „Es ist eine Erniedrigung“, sagt sie. Das gehe soweit, dass manche nur anstehen würden, um ihre Plätze in der Schlange später zu verkaufen.
Die Trennung von ihrem Sohn und die ständigen Grenzüberquerungen haben sie erschöpft. „Ich hatte einfach keine Kraft mehr.“ Deshalb holt Natalja ihren elfjährigen Sohn nach der Grundschule zu sich.
Kontakt in ihre Heimat zu halten, sei schwierig: „Die Post arbeitet ja nicht, wir können also nichts schicken.“ Und auch Telefon und Internet werden immer wieder ausgeschaltet, sodass sie manchmal keine Möglichkeit habe, ihre Freunde oder Eltern zu erreichen. Über Politik möchte Natalja eigentlich gar nicht mehr sprechen. Sie will sich da raushalten. Sie möchte mit ihrem Sohn „einfach überleben“. Wenn sie sich doch einmal politisch informieren möchte, dann macht sie das über Foren im Internet. Denn was im Fernsehen läuft, sei alles russische Propaganda.
Ihre Wohnung in ihrer früheren Heimatstadt Makejewka kann sie nicht verkaufen, weil es aktuell kaum Geld dafür gibt – dabei bräuchte sie es dringend. Mit ihrem Sohn zusammen in dem kleinen Zimmer zu wohnen, sei schwierig. Natalja leidet sehr unter dieser Situation. Sie sagt, dass ihre Gesundheit angeschlagen sei. „Meine Heimatstadt ist dort geblieben — meine Freunde und Kollegen sind in der ganzen Ukraine und darüber hinaus verstreut.“ Natalja atmet einmal tief ein. „Stellt euch vor, ihr lebt und es ist alles fest. Ihr habt Pläne, eine Arbeit und Familie. Ihr baut euer Leben auf – ihr plant es. Und dann kommt der Punkt, an dem ihr alles verliert. Alles was ihr hattet. Der Krieg hat unser komplettes Leben verändert und man kann es nicht mehr zurückholen.“