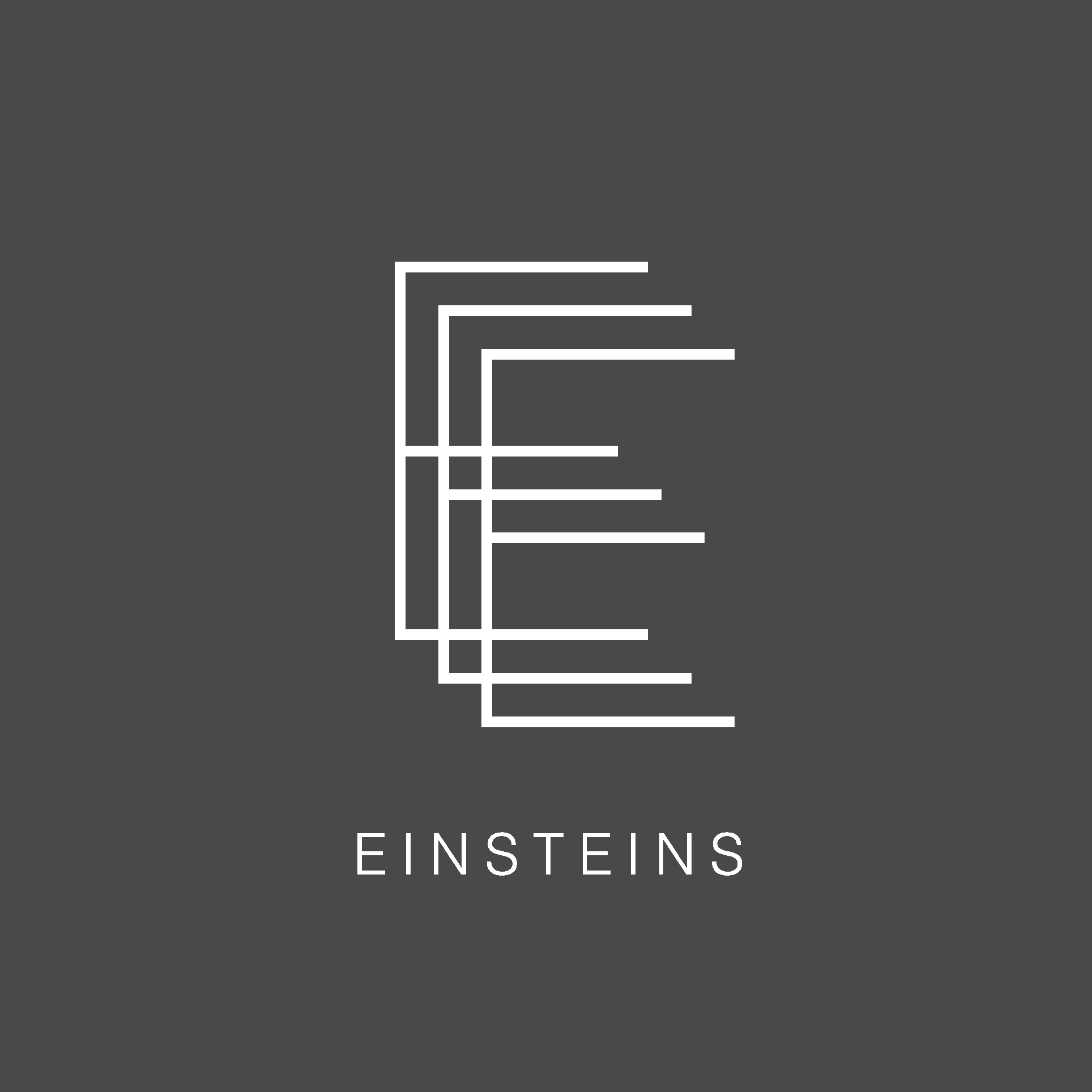die verlierer der wahl?
warum kleinparteien nicht aufgebenIn Deutschland gibt es neben den bekannten und großen Parteien auch unzählige Kleinparteien. Deren Mitglieder müssen oft mühsam um Stimmen kämpfen, nur um bei der nächsten Wahl wieder als “Verlierer” dazustehen. Aber was wollen sie dann überhaupt mit einer Teilnahme an den Bundestagswahlen erreichen?
Ein Interview mit dem Parteienforscher Erik Schlegel
Was ist eine Kleinpartei? Wo liegen da die Abgrenzungen, auch zu anderen Bezeichnungen?
Für alle weithin sichtbar sind die Parteien, die im Bundestag vertreten sind: Gerade SPD und Union, die schon seit 1949 dem Parlament angehören, sind “etablierte Parteien”.
Daneben gibt es auch “etablierte Kleinparteien”. Das sind also Parteien, die es nicht vermögen, einen Bundeskanzler zu stellen, aber beispielsweise dauerhaft im Parlament vertreten sind oder eine gefestigte Organisationsstruktur haben. Darunter zählen seit Mitte der 1980er Die Grünen, seit 2007 Die Linke und mit Abstrichen natürlich auch die FDP.
Nicht-etablierte Kleinparteien sind Parteien, die auch schon vom Wähler wahrgenommen werden, wie die Piraten, die Freien Wähler oder die ÖDP. Sie haben ein begrenztes Politikfeld und haben nicht die Mitgliederzahlen wie die gerade genannten Parteien. Sie tun sich auch schwer, bundesweit über fünf Prozent zu kommen.
Dann gibt es noch eine Stufe unter den nicht-etablierten Kleinparteien: die Kleinstparteien. Sie haben sogar damit zu kämpfen, auf dem Wahlzettel zu stehen. Ihre ganze organisatorische Kraft müssen Kleinstparteien letzten Endes darauf verwenden, auf Wahlzettel zu kommen, um überhaupt wählbar zu sein. Dazu zählen dann beispielsweise die „Partei der bibeltreuen Christen“ oder die „Partei der Vernunft“.
Es gibt ja relativ viele Kleinparteien in Deutschland. Können Sie einen Überblick geben, wie die Situation der Kleinparteien in Deutschland ist und warum sich das so entwickelt hat?
Grundlage des Parteienwettbewerbs ist das Parteiengesetz von 1967. Seitdem führt der Bundeswahlleiter eine Unterlagensammlung von allen Parteien. Allerdings ist diese Unterlagensammlung nicht vollständig. Aber wenn wir uns die Liste anschauen, die der Bundeswahlleiter führt, so können wir feststellen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland immer weit über 100 Parteien bestanden haben. Davon werden in der Bevölkerung natürlich nicht alle wahrgenommen. Die Kleinparteien haben auch eine unterschiedliche Lebensdauer, das heißt über die Jahre waren es nicht immer dieselben Parteien, sondern es gibt da eine hohe Fluktuation. Gerade Kleinparteien scheiden aus, lösen sich auf und neue kommen hinzu. Es gibt also einen ganz großen Austausch. Ich habe mal ausgerechnet, dass bis zu dem Zeitpunkt 2013 eine Partei, nach der Unterlagensammlung des Bundeswahlleiters, eine durchschnittliche Lebensdauer von rund 8,5 Jahren hat. Man muss dabei bedenken, dass eine Partei, wenn sie in die Unterlagensammlung aufgenommen wurde, sechs Jahre in der Unterlagensammlung bleibt. Wenn die Partei sechs Jahre lang an keiner überkommunalen Wahl teilnimmt, wird sie wieder aus dieser Liste gestrichen. Unter anderem dadurch kommt diese kurze Lebensdauer zustande.

Der Experte
Erik Schlegel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des CAP, Centrum für angewandte Politikforschung, in München. An der TU Chemnitz hat er zuvor Politikwissenschaft studiert und dort auch promoviert. Seine Dissertation „Quo vadis Piratenpartei?“ dreht sich um die (Nicht-)Etablierung von Kleinparteien. Sprich, wie sehr sich eine Partei im politischen System, in den Medien und in der Gesellschaft schon festigen konnte. Im Interview hat er uns unter anderem erklärt, was Kleinparteien eigentlich sind, wie sie sich entwickeln und wie ihre Situation in Deutschland aussieht.
Nun gibt es ja Kleinparteien, die existieren schon lange und müssen ständig darum ringen, überhaupt weiterhin eine Partei zu bleiben. Welche Motivation steckt da dahinter, trotzdem weiterzumachen?
Das sind unterschiedliche Motivationen. Das kommt auch ein Stück weit darauf an, welches Ziel die Kleinparteien verfolgen. Ist es Ziel der Partei, eine eigene Ideologie darzustellen, dann ist es natürlich der Faktor, diese Ideologie unbedingt im Parteienwettbewerb zu erhalten und als Wahlalternative den Wählern zu präsentieren. Dann gibt es auch Parteien, die ein Stück weit zur Selbstverwirklichung von einzelnen Personen dienen. Das bedeutet, hier ist es dann das Ziel immer weiterzumachen und sich selbst darzustellen. Dann gibt es Parteien wie „Die Partei“, die das politische System ad absurdum führen wollen. Die treten also immer und immer wieder an, um zu zeigen, wo die Schwachstellen liegen, wo vielleicht momentan Fehler im System sind. Diese wollen sie beständig immer wieder aufzeigen. Auch hier ist also der Antrieb inhaltlich.
Das heißt, nicht jede Partei “verliert” also, wenn sie nach der Wahl nicht die Regierungsmacht stellt? Manche wollen einfach immer weiter ihren inhaltlichen Standpunkt vorbringen?
Also wenn wir das politikwissenschaftlich betrachten, gibt es drei Wahlziele: Das ist einmal das „vote-seeking“: Sprich, jemand will unbedingt ein Amt haben, beispielsweise den nächsten Bundeskanzler stellen. Das trifft jetzt auf die SPD zu, aber natürlich auch auf die Union mit Frau Merkel. Dann gibt es Ziele, die inhaltlicher Natur sind. Dass Parteien also gezielt Inhalte umsetzen wollen und das im Vorfeld der Wahl auch kommunizieren. Und dann gibt es auch das Ziel, repräsentiert zu sein. Ganz zentral zum Beispiel will die FDP im nächsten Bundestag repräsentiert sein, um bundespolitisch wieder eine stärkere Relevanz im Parteiensystem zu erhalten. Das gleiche Ziel hat natürlich die AfD, die auch versucht, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen. Auch “Die Grünen” und “Die Linken” setzen sich unter anderem den Einzug in den Bundestag zum Ziel. Diese Parteien haben jetzt aber nicht unbedingt den Anspruch, das Regierungsoberhaupt zu stellen bzw. eine feste Anzahl an Ministerposten. Das ist dann eher sekundär. Die drei Ziele Inhalt, Regierungsämter und Repräsentanz im Parlament können natürlich auch gleichzeitig verfolgt werden. Bei Kleinstparteien spielt dabei sicherlich der Inhalt eine wichtige Rolle; und bei nicht-etablierten Kleinparteien wie der ÖDP oder der Bayernpartei auch die Repräsentanz in einem Parlament, weil sie ein Stück weit auch ihr Dasein legitimiert.
Kann man dann sagen, je kleiner eine Partei ist, desto mehr verfolgt sie inhaltliche Ziele? Denn manche schaffen es ja nicht einmal, zur Bundestagswahl zugelassen zu werden, geschweige denn im Parlament repräsentiert zu sein.
Nicht etablierte Kleinparteien haben oft sehr starke Probleme, überhaupt in allen Bundesländern zur Wahl anzutreten. Deswegen müssen auch fast in jedem Bundesland andere Wahlzettel gedruckt werden, weil es die Kleinparteien nicht in allen Bundesländern auf den Wahlzettel schaffen. “Die Violetten” und “Die Frauen” sind beispielsweise bei der letzten Bundestagswahl nur in Bayern angetreten. Für diese Parteien geht es bei Wahlen also auch ein Stück weit darum, die eigenen Mitglieder zu mobilisieren und die eigene Organisation zu testen: Schaffen wir es, die nötigen Unterstützungsunterschriften zu sammeln? Schaffen wir es, ein Programm zu erstellen? Das gehört bei Kleinparteien mit dazu: Sich stärker mit sich selbst beschäftigen, um Ziele zu definieren, um Mitglieder zu binden, um neue Mitglieder anzuwerben und Inhalte zu platzieren.
Was sind Kleinparteien?
Der Begriff “Kleinparteien” ist in der Politikwissenschaft nicht eindeutig definiert. Synonym sprechen Politikforscher auch von “Splitterparteien”, “sonstigen Parteien” und “anderen Parteien”. Stufenweise lassen sie sich außerdem in “Klein-” oder “Kleinstparteien” sowie “etablierte” und “nicht-etablierte Kleinparteien” einteilen. Aber auch dabei sind die Abgrenzungen nicht trennscharf. In den folgenden Texten sprechen wir, zur besseren Verständlichkeit, immer nur von “Kleinparteien” und meinen damit Parteien in den Größenordnungen von Bündnis C und den Violetten bis hin zu den Piraten und zur ÖDP – also die “nicht-etablierten Kleinparteien” und die “Kleinstparteien”. Die Violetten sind zum Beispiel unter den allerkleinsten Parteien mit rund 700 Mitgliedern und nur vereinzelten Landesverbänden. Die Piraten dagegen haben schon fast 12.000 Mitglieder und in jedem Bundesland einen Verband.
Welches Wahlsystem wäre dann für Kleinparteien von Vorteil?
Grundsätzlich betrachtet gibt es einen großen Unterschied zwischen Mehrheitswahl und Verhältniswahl. Die beiden Systeme haben unterschiedliche Zielfunktionen: Bei der Mehrheitswahl ist das Hauptziel, eine regierungsfähige Mehrheit zu erhalten. In Großbritannien gibt es die Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen: Nur der Bewerber mit den meisten Stimmen gewinnt, alle anderen Stimmen fallen unter den Tisch. Bei der Verhältniswahl ist das Ziel, die Gesellschaft spiegelbildlich im Parlament zu repräsentieren. Das heißt, dass jede Minderheitenmeinung in einer verhältnismäßigen Anzahl ihre Vertretung im Parlament findet. In Deutschland haben wir ein Verhältniswahlsystem mit der Einschränkung der Fünf-Prozent-Hürde. Kleinparteien haben es bei Verhältniswahlsystemen leichter, weil dadurch die natürliche Zugangshürde viel niedriger ist.
Welche Chancen und Hindernisse bietet das deutsche Wahlsystem den Kleinparteien dann genau?
Für Kleinparteien ist es schwierig, auf den Wahlzettel zu kommen. Das hat natürlich einen Hintergrund: Organisatorisch wäre es sehr aufwendig, wenn jede Person, die eine Partei gegründet hat, auf den Wahlzettel kommt. Hier wird also selektiert, damit die Ernsthaftigkeit einer Partei und des Wahlaktes unterstrichen wird. Die Wahl ist in der Demokratie der höchste Akt: Hier kommt der Wählerwille, die Volkssouveränität, zum Ausdruck. Wenn man Ein-Mann- oder Ein-Frauen-Parteien zulässt, führt man das ein Stück weit ad absurdum.
Wie sieht diese Selektion im Vorfeld genau aus? Das größte Hindernis sind sicherlich Unterstützungsunterschriften. Parteien, die nicht im Bundes- oder Landtag vertreten sind, müssen diese sammeln, um auf die Landeslisten zu kommen. Pro Bundesland müssen die Parteien maximal 2.000 Unterschriften sammeln, oder mindestens ein Tausendstel der wahlberechtigten Bürger muss unterschreiben. Kleinparteien versuchen, ihre Kräfte zu bündeln. Sie versuchen also in den mitgliedsstärksten Bundesländern auf die Listen zu kommen und sich regional zu etablieren, um dann vielleicht später bundespolitisch aktiv zu werden.
Das Parteiengesetz
Das bis heute gültige Parteiengesetz wurde am 24.07.1967 verabschiedet. Darin sind alle näheren Regelungen des Parteienrechts verankert. Die gelten natürlich für alle Parteien gleich – aber es gibt einige Punkte, auf die Kleinparteien besonders achten müssen:
- Eine Partei muss alle sechs Jahre an einer Bundes- oder Landtagswahl teilnehmen.
- Eine Partei muss eine schriftliche Satzung und ein schriftliches Programm haben. Beides muss der Vorstand dem Bundeswahlleiter vorlegen.
- Der Vorstand muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. Ansonsten gibt es keine vorgegebene Mitgliederzahl. Um eine Partei zu gründen, reichen also drei Leute.
- Jede Partei kann staatliche Teilfinanzierung erhalten, wenn sie die nötigen Vorgaben dafür erfüllt.
Wie schätzen Sie die Chancen der Kleinparteien bei der Bundestagswahl 2017 ein?
Rund 100 Tage bis ungefähr 50 Tage vor der Wahl entscheidet sich, ob die Parteien zur Wahl zugelassen werden. Daher sammeln die Kleinparteien in diesem Zeitraum verstärkt Unterstützungsunterschriften. Dann müssen sich die Parteien zur Wahl anmelden und die Parteieigenschaft muss festgestellt werden. Diese hohe organisatorische Hürde muss im Vorfeld von den Kleinparteien erst einmal genommen werden. Wenn wir uns die letzten Wahlen anschauen, werden das auch diesmal wieder einige Kleinparteien schaffen, andere werden daran scheitern. Zudem gibt es auch Kleinparteien, die versuchen werden, die Fünf-Prozent-Hürde in Angriff zu nehmen, beispielsweise die Piratenpartei, die AfD und die Freien Wähler. Dann gibt es Kleinparteien, die versuchen, die 0.5-Prozenthürde für die staatliche Teilfinanzierung zu überwinden. Dazu zählen die ÖDP oder die Republikaner. Bei der Wahl 2013 hat die Fünf-Prozent-Hürde ihre volle Wirkung entfaltet. Über 15 Prozent der Wählerstimmen sind letzten Endes nicht im Parlament repräsentiert. Die FDP und die AfD sind beide mit über vier Prozent gescheitert. Nach aktuellen Wahlumfragen und den Landtagswahlen zufolge haben die AfD und die FDP jedoch gute Chancen, die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden.
3 fragen - 3 antworten
die autoren

interview & video tabea goppelt

interview & video anna berchtenbreiter