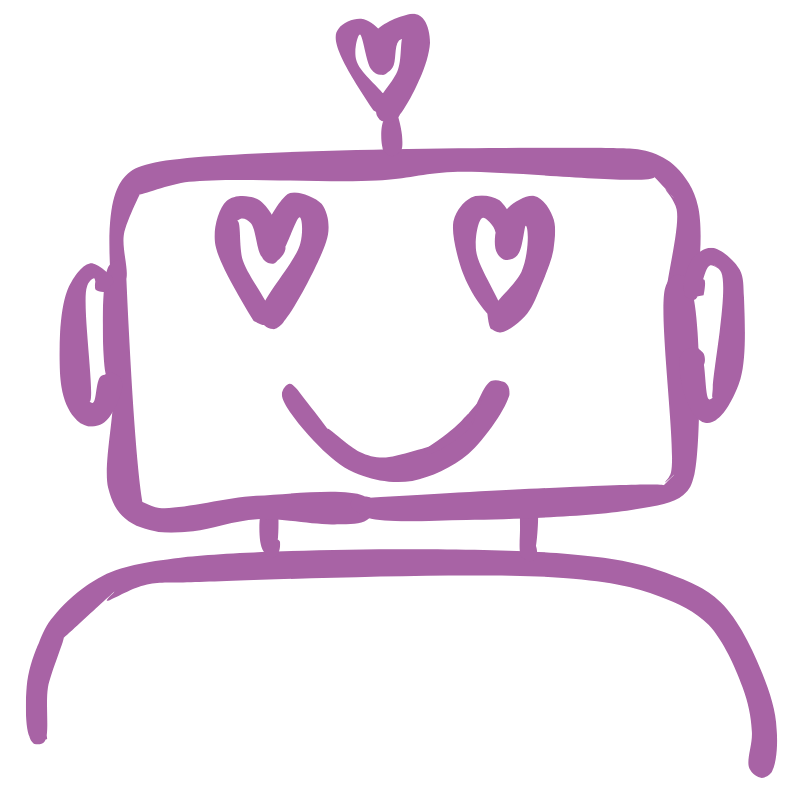Warum möchten Menschen heute wie im Mittelalter leben, Professor Patzold?
Helden, Gemetzel, Sagen: Das Mittelalter fasziniert und fesselt auch noch heute viele Menschen. Steffen Patzold, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Eberhard Karls Universität Tübingen, erklärt, was diese Faszination ausmacht und welche Gefahren sie mit sich bringt.
von Maria Fashchevskaya

einsteins: Welche Menschen begeistern sich für das Mittelalter und warum?
Patzold: Ich glaube, dass es da ein ganz breites Spektrum gibt: Zum einen Menschen wie am Campus Galli, einem Ort in Meßkirch in Baden-Württemberg. Da wird mit den Mitteln des neunten Jahrhunderts das Kloster St. Gallen bzw. der Klosterplan von Sankt Gallen nachgebaut. Das sind Menschen, die als Handwerker, zum Teil auch als Akademiker, mit einem bestimmten Wissen vor Ort sind und versuchen, mit den Mitteln der mittelalterlichen Zeit ein ganzes Kloster zu bauen. Etwas Ähnliches gibt es auch in Frankreich mit einer Burg. Das Unternehmen in Meßkirch ist also an der Grenze zwischen wissenschaftlicher Forschung, historischer Erkenntnis und Public History [definiert jegliche Geschichtsdarstellungen in der Öffentlichkeit, Anm. d. Red.] angesiedelt.
Prof. Dr. Steffen Patzold

Prof. Dr. Steffen Patzold ist seit 2007 Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Er beschäftigt sich vor allem mit dem frühen und hohen Mittelalter und den Wahrnehmungs- und Deutungsmustern der Epoche. Patzold fasziniert, wie das Mittelalter die heutige Zeit geprägt hat. Trotzdem hätte er selbst nicht zu dieser Zeit leben wollen. Er sagt: „Ich genieße es schon sehr, dass es moderne Anästhesie und heißes Wasser zum Duschen gibt.”
Wie kann man eine Glocke in dieser Zeit gießen? Wie hat man damals getöpfert und mehr… Das ist experimentelle Archäologie. Gleichzeitig geht es aber natürlich auch darum, Touristen anzuziehen, ein breites Publikum zu gewinnen und den Menschen einen guten Nachmittag zu bieten, wenn man sich dort in Meßkirch über das Gelände bewegt.
Daneben gibt es aber auch eine breite Gruppe von Menschen, die das Mittelalter einfach interessant oder spannend finden. Sie empfinden die Redensarten als lustig oder die Kleidung interessant. Sie würden aber wahrscheinlich nicht sagen: „Das ist mein Hobby!“. Sie suchen einfach mal eine Abwechslung vom Alltag.

Kann man durch die Möglichkeit der Flucht aus dem heutigen Alltag auch die Faszination für das Mittelalter allgemein beschreiben?
Man muss unterscheiden: Es gibt diejenigen, die in einer Szene unterwegs sind und Details von Rüstungen oder Kleidungen kennen. Das ist ein Wissen, was nicht notwendigerweise in einem Studium der Geschichte vermittelt wird. Aber: hilfreich! Daneben steht das breite populäre Interesse, was sich auf Mittelaltermärkten oder in Fantasy-Serien wie „Game of Thrones“ widerspiegelt. Man kann auch zum Beispiel Tolkien [Autor von „Der Herr der Ringe“, Anm. d. Red.] dafür vereinnahmen. Das ist erstmal ein anderes Interesse, eines für das Exotische und Fremde: Ähnlich wie bei Fernreisen im Raum reisen wir mit dem Mittelalter in eine ferne und merkwürdige Zeit.
Über das Projekt Campus Galli
Der Campus Galli ist eine Klosterbaustelle in Meßkirch, Baden-Württemberg. Mit Mitteln des neunten Jh. wird dort ein Kloster auf Grundlage der alten Pläne des St. Galler Klosterplans rekonstruiert. Die Abtei St. Gallen befindet sich im schweizerischen St. Gallen, etwa 66 Kilometer Luftlinie von Meßkirch entfernt. Heute gehört die Abtei zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Campus Galli wird jährlich von tausenden Interessierten besucht.
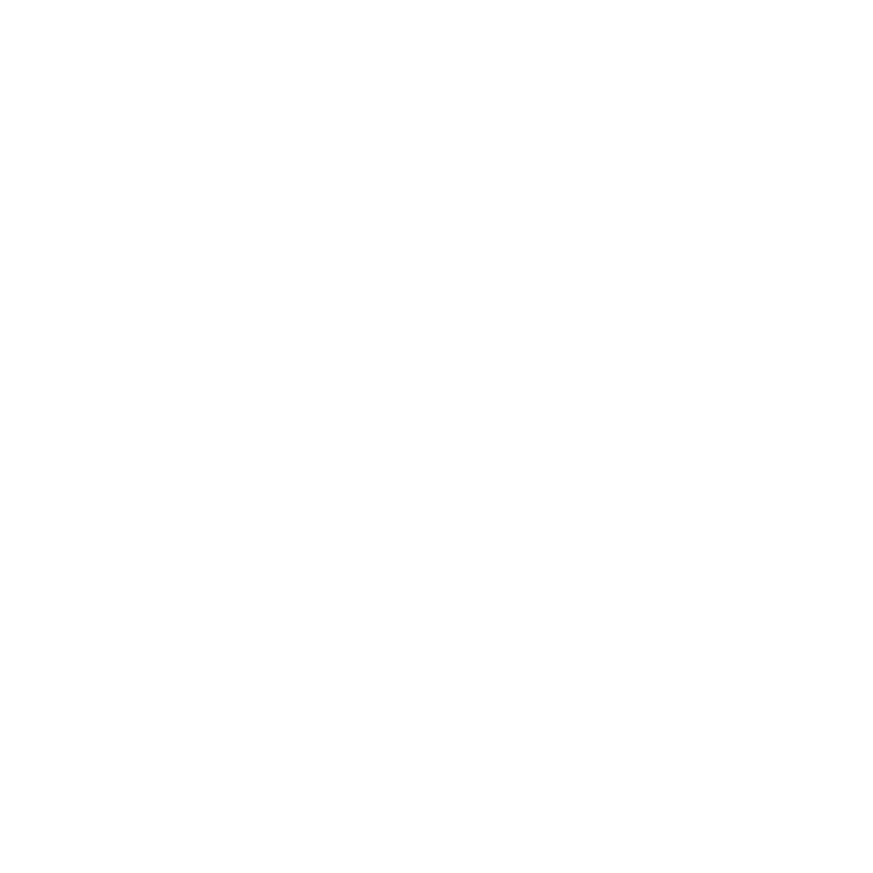
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den vielen erhaltenen mittelalterlichen Burgen in Deutschland, z. B. im Rheinland, und der großen Mittelalterszene hierzulande?
Ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt für Interesse an Geschichte. Das beginnt allein schon beim Ortsjubiläum. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Ort zum ersten Mal vor genau 1000 Jahren genannt worden ist, fangen Sie an, sich für das Mittelalter zu interessieren. Dann fragen Sie bei Universitäten an, dieses Ereignis entsprechend wissenschaftlich aufzubereiten, die Ortsgeschichte zu schreiben oder einen Vortrag zu halten. Und ja, auch Burgen gehören unmittelbar mit dazu. Man muss allerdings immer aufpassen, welche Burgen tatsächlich so alt sind – und welche uns eher die Mittelalterrezeption des 19. Jahrhunderts zeigen.
„Ich bewundere die Mittelalterszene, weil dort eine Expertise für bestimmte Aspekte herrscht, die ich selbst nicht habe.“
Steffen Patzold, Professor für Mittelalterliche Geschichte

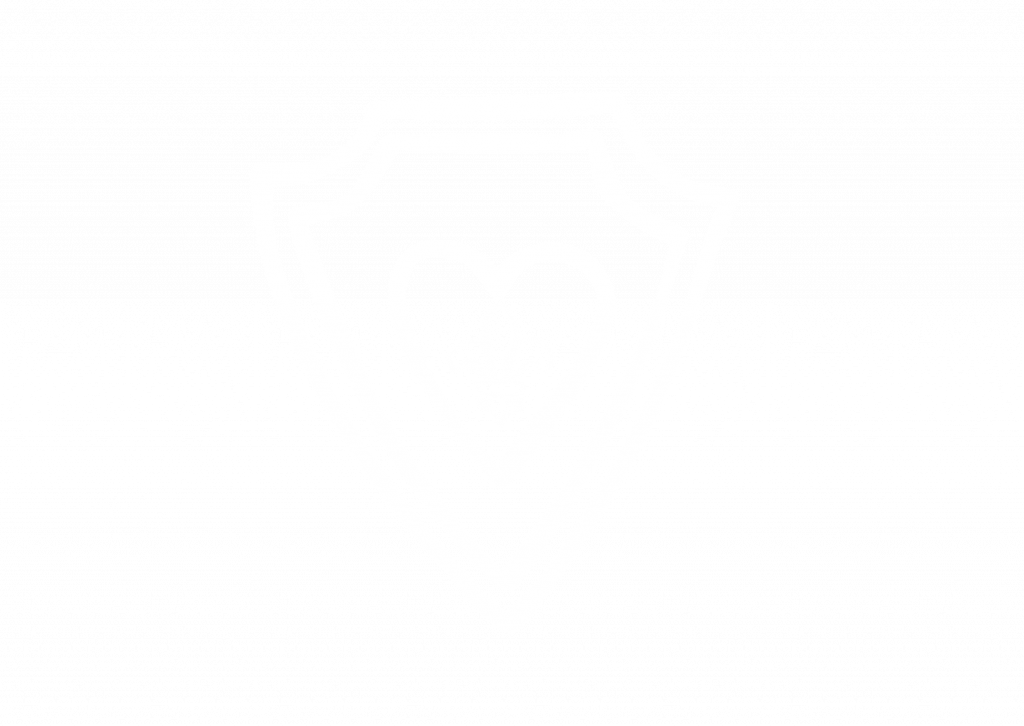
Auch wegen der europäischen Geschichte gibt es eine große Mittelalterszene in Deutschland. Wie sehen Sie als Experte diese Mittelalterszene – bzw. die Liebe zur Epoche des Mittelalters?
Zunächst einmal freue ich mich, dass sich Menschen für die Geschichte damals interessieren. Davon leben wir ein bisschen: Wir können ja alles Mögliche erforschen an Universitäten, aber wenn sich außerhalb unseres Elfenbeinturms niemand dafür interessiert, wird es schwierig.
Ich bewundere die Mittelalterszene, weil dort eine Expertise für bestimmte Aspekte herrscht, die ich selbst nicht habe. Da bin ich als Historiker und Experte manchmal überfragt. Vieles, was materielle Kultur angeht, kann ich nicht gut beurteilen. Zum Beispiel weiß ich nicht, wie bestimmte Techniken des Webens ausgesehen haben; da sind Archäologen meistens dichter dran als wir Historiker. Aber in der Mittelalterszene gibt es Menschen, die etwas mitbringen, von dem umgekehrt wir lernen können. Insofern finde ich es großartig, wenn sich Menschen für diese ziemlich ferne Epoche interessieren.

Mittelaltermärkte werden in ganz Deutschland organisiert und ziehen jährlich ein breites Publikum an. Sehen Sie in der Liebe zum Mittelalter auch Freiheiten für das Publikum, in denen sich Menschen entfalten können?
Ja, unbedingt: Es geht ja nicht darum, dort das Mittelalter wissenschaftlich aufleben zu lassen. Wir würden heute wahrscheinlich das Meiste, was damals gekocht wurde, auch gar nicht essen mögen oder wollen. Auf diesen Mittelaltermärkten wird heutiges Essen gekocht. Und das ist auch gut so!
Mittelalterliche Mönche, zum Beispiel, aßen im Wesentlichen gekochte Bohnen. Das wissen wir zum Beispiel aus den Konstitutionen aus dem Kloster Hirsau: Dort wird genau beschrieben, wie die Bohnen gekocht werden müssen. Tagein, tagaus Bohnen, die nicht gesalzen und nicht gewürzt sind – das wäre für uns wahrscheinlich nicht so lecker. Die Mehrzahl der Menschen, die nicht reich waren, dürften täglich irgendeine Form von Getreidebrei gegessen haben, der vielleicht ein bisschen gesüßt durch Kompott oder Obst war, aber das war’s dann auch schon. Gewürze waren eben ziemlich teuer und Luxus.
Auf den Märkten geht es aber ja auch darüber hinaus: Schausteller versuchen, „mittelalterlich“ zu reden, also die damalige Sprache nachzumachen. Aber es bleibt natürlich Neuhochdeutsch, nur mit ein bisschen altertümlichen Wendungen. Wir reden nicht Mittelhochdeutsch, gar Althochdeutsch oder eine frühe Form der romanischen Sprachen.
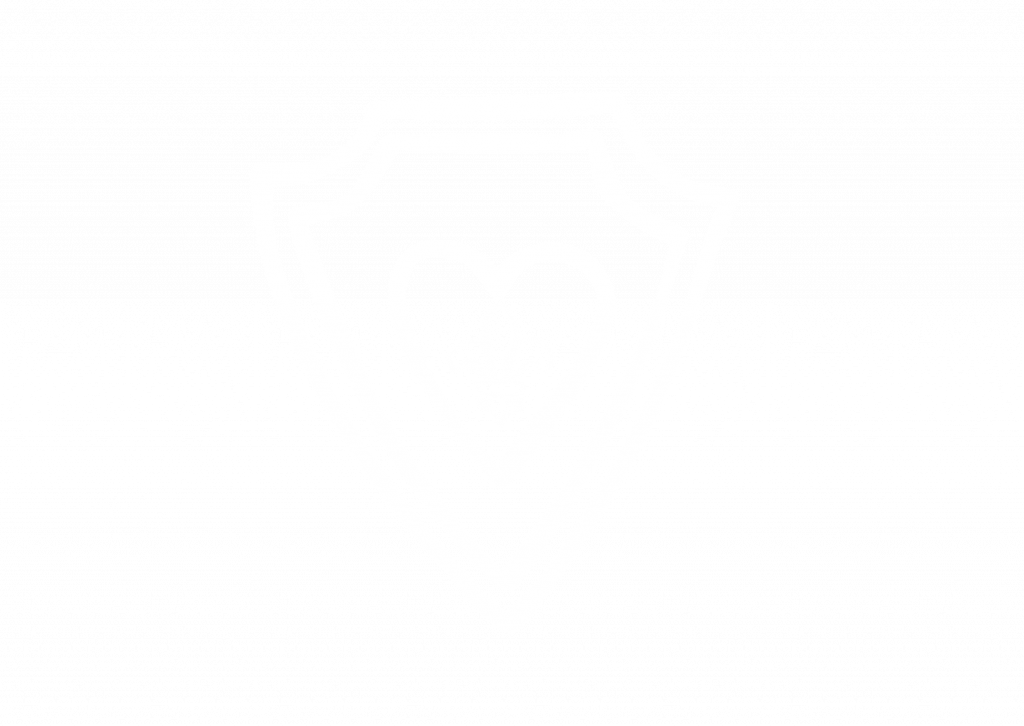
„Der Zweck dieser Mittelaltermärkte heute ist eben nicht eine wissenschaftliche Zeitreise – sondern dem Alltag zu entfliehen.“
Steffen Patzold, Professor für Mittelalterliche Geschichte

Dann unterscheiden sich gegenwärtige Mittelaltermärkte massiv von zeitgenössischen.
Mittelaltermärkte heute haben immer den Charme, dass sie uns eine ferne Zeit vorspiegeln. Märkte waren damals Orte, an denen man Handel treiben konnte. Das war ein Privileg, weil damit Einnahmen verbunden waren. Man musste zahlen, wenn man auf dem Markt handeln wollte. Die Abgaben waren eine Einkommensquelle. Es konnte auch nicht jeder einfach einen Markt eröffnen, sondern man musste dafür das Recht erhalten.
Märkte waren außerdem wichtige Orte, weil sie Knotenpunkte waren. Aus ihnen konnten Städte entstehen und sie förderten das Gedeihen einer Stadt. Was Mittelaltermärkte heute attraktiv macht, waren sie gerade nicht: Sie dienten nicht dem Vergnügen und der Flucht aus dem Alltag in eine andere Zeit. Und Ritterturniere gehörten übrigens auch nicht dazu…
Heutzutage werden trotzdem Ritterturniere oft mit mittelalterlichen Märkten verbunden.
Da sehen Sie, welches Bild Menschen vom Mittelalter haben: Mittelalter heißt Ritter. Aber Ritter sind eine Gruppe, die es nicht immer im Mittelalter gab: In den ersten 600 Jahren des Mittelalters gab es sie nicht. Sie prägten die Kultur – in großen Teilen Europas – erst ab dem 11./12. Jahrhundert.
Wie authentisch sind Ritterturniere?
Jedoch sind genau Reenactments von Ritterturnieren sehr populär in der Gegenwart. Diesen wird oft eine fragwürdige Authentizität vorgeworfen. Welche Gefahren verbergen sich in den Reenactments?
Die Gefahr liegt einfach darin, dass wir denken, so sei es wirklich gewesen, und dabei sehr viele Fakten ausblenden. Wir sehen uns immer nur bestimmte Ausschnitte aus dem damaligen Geschehen an – schon, weil wir es anders aus guten Gründen kaum ertragen könnten. Man darf die Reenactments nicht mit der Realität von vor 1000 Jahren verwechseln: Wir möchten nicht an Tuberkulose sterben. Wir sind froh, dass es Antibiotika gibt und wir freuen uns, dass wir ein Individuum sein dürfen. Man muss einfach im Kopf behalten, dass es nie authentisch sein kann, weil wir immer eine Kluft haben werden zwischen der Vergangenheit und unserer Gegenwart. Es wäre auch ethisch gar nicht verantwortbar, es noch authentischer zu gestalten. Wollen wir bei einem Schaukampf im Falle der Fälle wirklich auf einen Rettungsarzt und moderne Medizin verzichten?
Reenactments
…aus dem Englischen „Nachspielungen“, sind akribische Rekonstruktionen historischer Ereignisse oder Traditionen, die in einer Aufführung lebendig gemacht werden. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung sind Reenactments mit einer Zeitmaschine vergleichbar und veranschaulichen die Vergangenheit in der Gegenwart. Sie zeigen historisch markante Ereignisse (inter-)nationaler, kultureller Geschichte, indem sie diese in der „Nachspielung“ nachstellen und dem Publikum eine Erfahrung der Vergangenheit am eigenen Körper als „Live-Erlebnis“ ermöglichen.
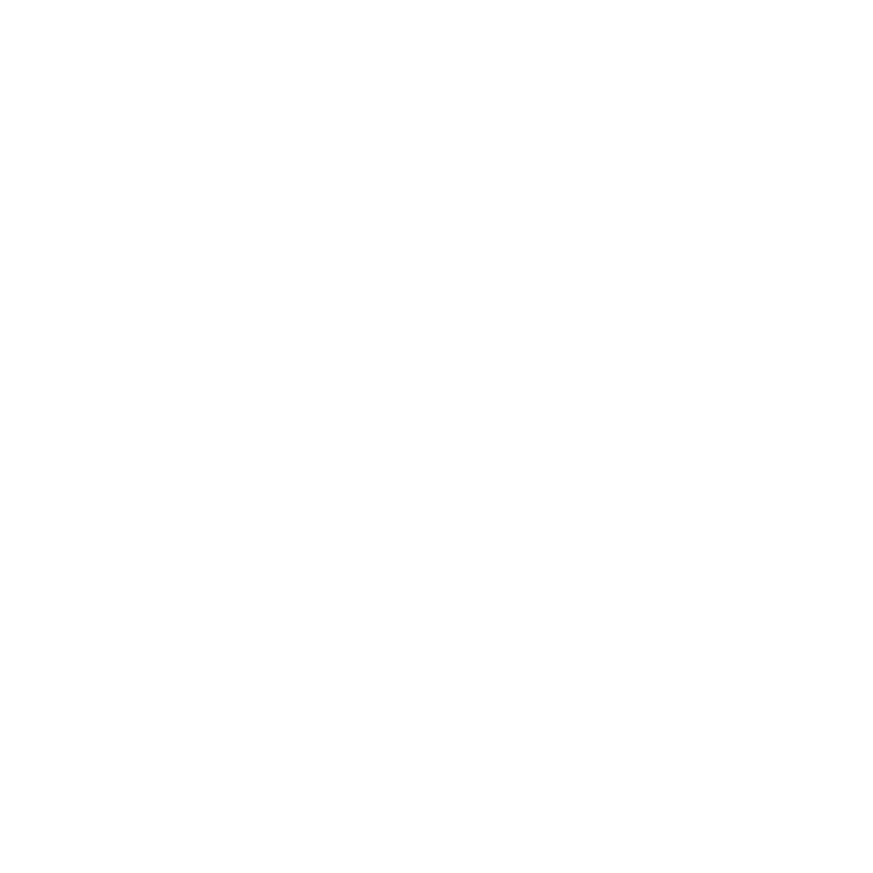
Man kann das Äußerliche oft sehr präzise nachahmen. Das sagt uns auch viel über damalige Möglichkeiten: Wenn ich weiß, wie schwer oder flexibel eigentlich eine Rüstung gewesen ist, dann hilft mir das auch wissenschaftlich bei der Frage weiter, wie ich mir solche Kämpfe vorstellen muss. Es ergibt deshalb viel Sinn, auszuprobieren, was damals ging und was nicht ging. Aber man soll nicht meinen, in diesem Moment sei man wirklich im Mittelalter: Man kann nicht wirklich ins Mittelalter eintauchen.
Wir sind immer noch Menschen unserer Zeit. Allein schon die Tatsache, dass wir uns in eine bestimmte Situation begeben, verkleiden und zu einem bestimmten Ort fahren müssen, um in dieser Situation es zu erleben, macht es zu etwas anderem, als es für die Zeitgenossen je wäre. Noch einmal: Es geht für uns um eine zeitlich begrenzte Flucht in eine andere Welt. Das kann nie den Anspruch haben, es wäre „authentisch mittelalterlich“.
„Das kann nie den Anspruch haben, es wäre ‚authentisch mittelalterlich‘.“
Steffen Patzold, Professor für Mittelalterliche Geschichte

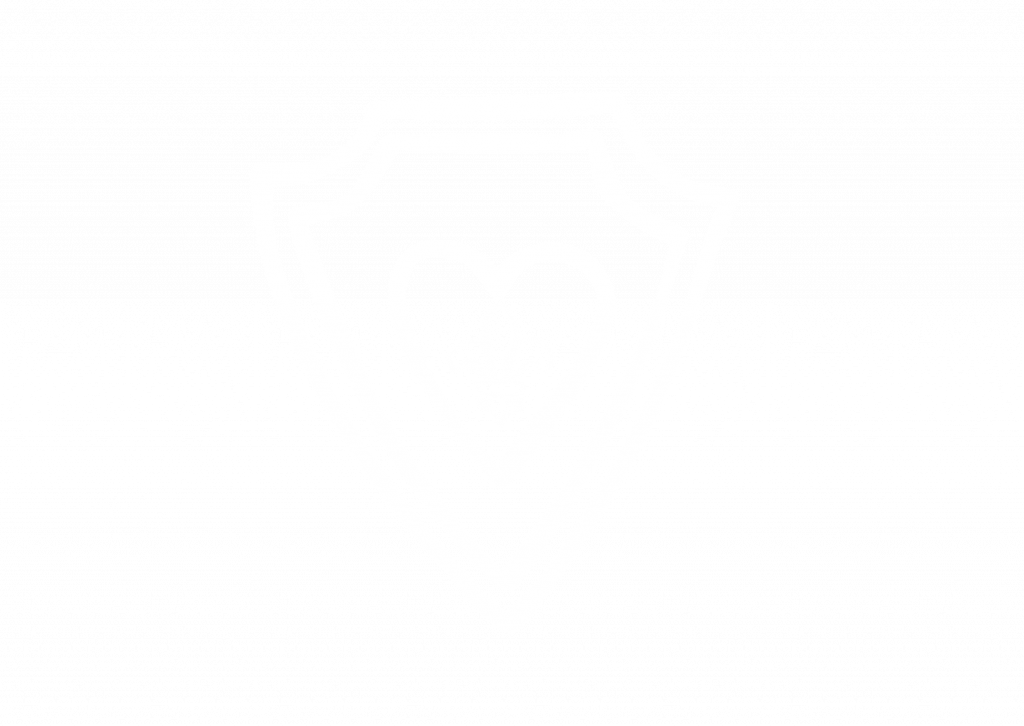
Da es auch ein Weg aus dem Alltag ist, wird das Mittelalter von Menschen romantisiert?
Aber kräftig! Wenn es hart auf hart kommt, möchte wahrscheinlich niemand wirklich zurück in eine Zeit, in der es keine medizinische Versorgung wie heute gegeben hat, mit sehr viel Intoleranz, einem merkwürdigen Menschenbild – eine Zeit, in der Menschen nicht gleich viel wert gewesen sind. Die kräftige Romantisierung ist von Anfang an Teil des Interesses am Mittelalterbild gewesen.
Wo sehen Sie den Übergang vom historischen Mittelalter zum Mittelalter, das heutzutage romantisiert wird?
Wenn ich Sie jetzt fragen würde, woran denken Sie, wenn Sie das Wort Mittelalter sagen? Sie würden an Burgen und Ritter denken, vielleicht sogar an Hexen, an Krieg und Gewalt, Kreuzzüge oder das Lehenswesen. Das ist aber eine spezifische Zeit innerhalb der langen Epoche des Mittelalters, nämlich die Periode, die im Laufe des 11. Jahrhunderts anfängt und nur bis zum 13. Jahrhundert andauert. Das, was wir als populäre Mittelaltervorstellung haben, ist damit eigentlich nur ein sehr spezifischer Ausschnitt aus der langen Epoche zwischen 500 und 1500. Und der betrifft auch nur eine bestimmte Region: Wir denken bei Mittelalter ziemlich selbstverständlich an West- und Mitteleuropa, aber zum Beispiel eher nicht an das islamisch geprägte Spanien oder Süditalien.
Buchempfehlung des Experten
Es sei schwierig, ein Buch auch eher zum Lesevergnügen zu finden, das aber mit geschichtlichen Details aufgeladen sei, sagt Professor Patzold. „Der Name der Rose“ von Umberto Eco ist aus der Perspektive eines Wissenschaftlers und Kenners des Mittelalters geschrieben. Trotzdem sei es eine Geschichte, die in der Moderne spielt.
Ein Klassiker des Faches ist „Die Feudalgesellschaft“ von Marc Bloch. Doch am faszinierendsten bleiben die Quellen der damaligen Zeit.
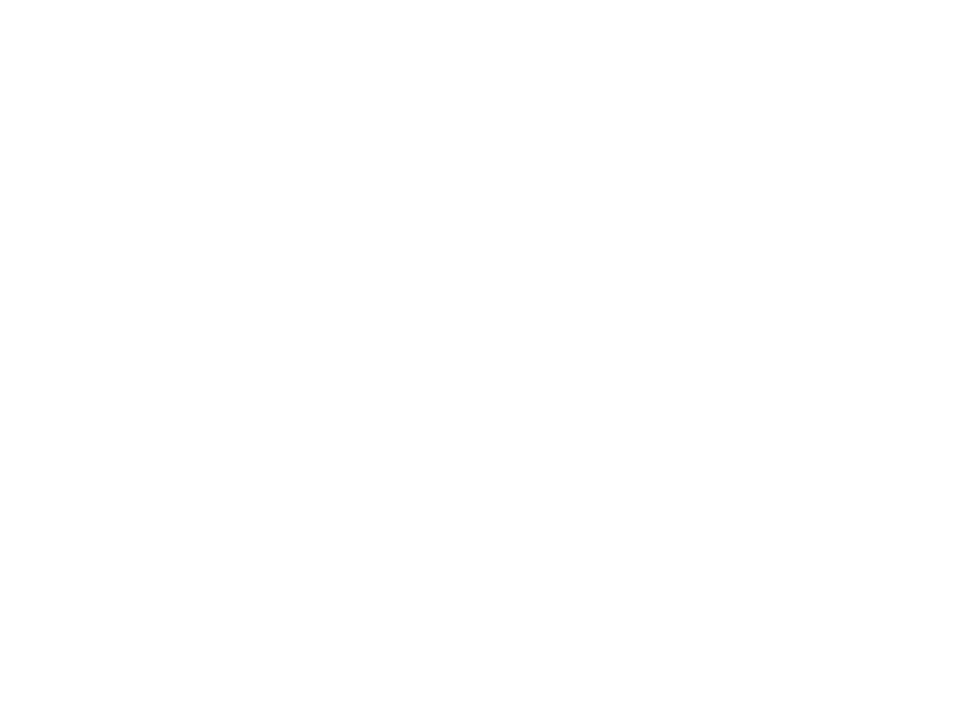
Erheben wir Ideale aus dem Mittelalter?
Da muss man sich Rosinen rauspicken, damit die Romamtisierung gut funktioniert: Man kann sich Ritterideale rauspicken und sich vorstellen, dass es um Heldentum, Abenteuer und Aventüre geht; und zugleich ignorieren, dass es im Hochmittelalter Söldnerheere und Chirurgie ohne Anästhesie gab und ziemlich große Brutalität herrschte. Es ist insofern eine idealisierte Welt.
Sehen Sie da Gefahren für das historische, wissenschaftliche Mittelalter in der Romantisierung?
Die Gefahr sehe ich überhaupt nicht da, wo Interessierte sich einen guten Nachmittag machen wollen, weil sie auf Mittelaltermärkte gehen. Von vornherein ist klar, dass diese Veranstaltungen nicht wissenschaftlich sind. Ich sehe auch keine Gefahr dort, wo man „Königreich der Himmel“ [historischer Film, spielt zu Zeiten der Kreuzzüge des 12. Jh., Anm. d. Red.] im Kino ansieht und einfach zwei Stunden gute Unterhaltung hat.
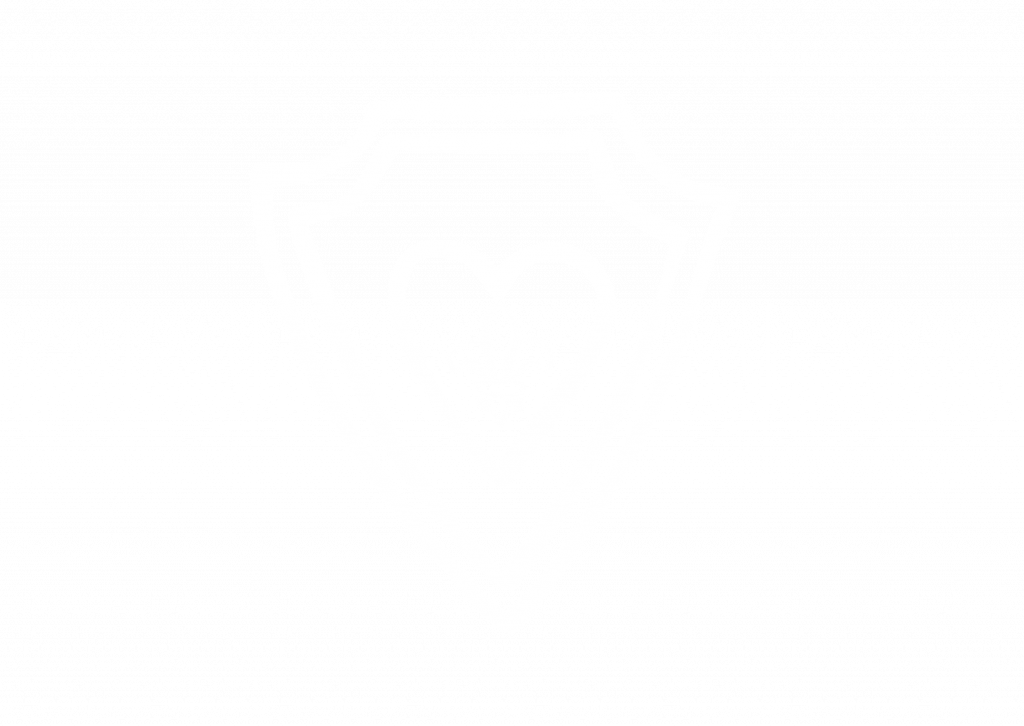
„Wo ich eher eine Gefahr sehe, ist im politischen Gebrauch des Mittelalters.“
Steffen Patzold, Professor für Mittelalterliche Geschichte

Wo sehen Sie eher die Gefahr von der Liebe zum Mittelalter?
Wo ich eher eine Gefahr sehe, ist im politischen Gebrauch des Mittelalters. Ich habe Schwierigkeiten damit, wenn Geschichte politisch instrumentalisiert wird. Da geht es um den politischen Missbrauch des Mittelalters zu Zwecken der Bildung eines Nationalbewusstseins.
Also ist der Zweck und das Ziel, Aspekte der mittelalterlichen, lokalen Geschichte für Konzeptbegründungen zu benutzen.
Es ist eine Vorstellung, dass Geschichte und gerade die mittelalterliche Geschichte zu einem deutschen Nationalbewusstsein beitragen soll. Das ist gerichtet gegen andere Identitätskonstruktionen, die wir genauso haben können. Es geht darum, „Deutschsein“ in einer bestimmten Weise zu definieren, und zwar so, dass man viele Menschen in Deutschland damit ausschließt. Das hat mit einem staatsbürgerlichen Verständnis nichts gemeinsam.
Ist der Name für den Karlspreis gerechtfertigt?
Sehen Sie öfter die Instrumentalisierung der Geschichte?
Die Gefahr, dass Geschichte instrumentalisiert wird, gibt es bei der Geschichte immer. Das geht allerdings in beide Richtungen. Zum Beispiel, wenn man die Seite liest, auf der der Aachener Karlspreis präsentiert wird: Auch dort benutzt man den Namen Karls des Großen und mittelalterliche Geschichte zu politischen Zwecken, finde ich. Ich selbst mag diese Zwecke politisch sympathisch finden, weil ich europäische Integration wichtig, gut und richtig finde.
Aber der Gebrauch der Geschichte bleibt trotzdem schwierig: Denn Karl der Große wird hier zu einem Einiger Europas erklärt. Das war er in gewisser Weise, ja; aber er hat Europa mit Waffengewalt erobert. Er war ein intoleranter Mensch, der klare Vorstellungen hatte, dass jeder ein Christ sein muss. Einen Preis nach ihm zu benennen und es in dieser Weise zu begründen, finde ich schwierig, auch wenn man das Richtige möchte. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist auch das ein Missbrauch von Geschichte.
Der Aachener Karlspreis
Der Aachener Karlspreis hat seinen Ursprung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Initiator:innen des Preises benannten ihn nach Karl dem Großen, da er als erster Einiger Europas gilt. Seine Herrschaft sei geprägt von Reformen in Verwaltung, Justiz und Gesetzgebung. Laut eigener Definition ehrt der Preis Persönlichkeiten, die sich für die europäische Einigung einsetzen. 2025 bekam Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, den Preis verliehen.
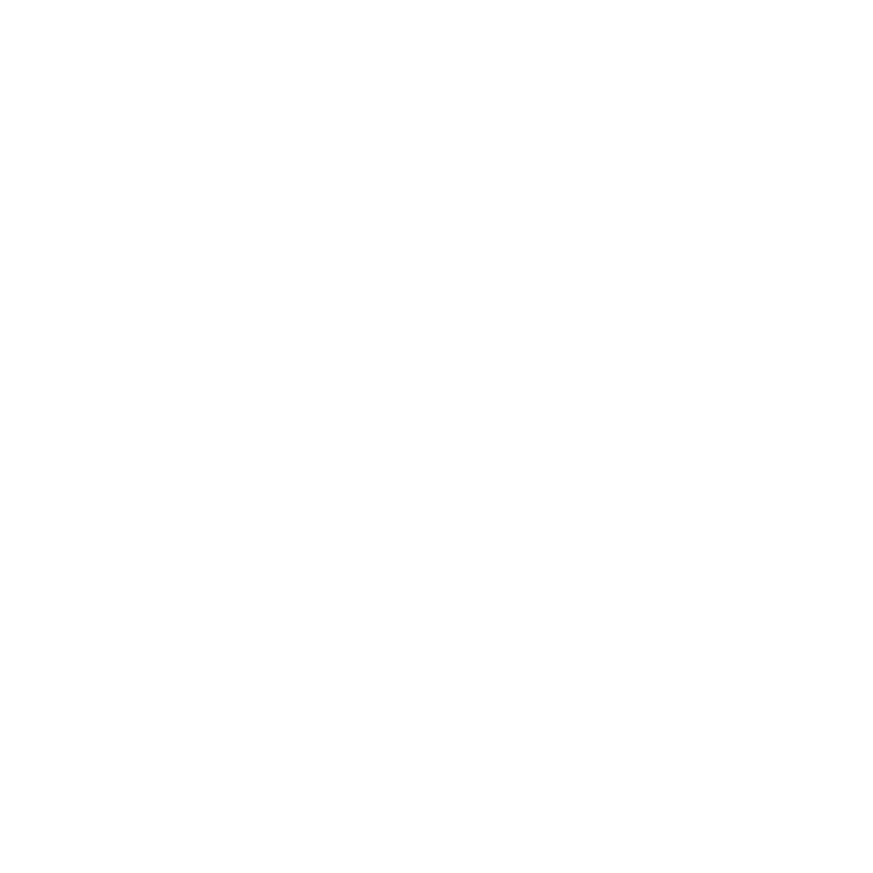
Mit der Faszination für das Mittelalter und der Gefahr des politischen Missbrauchs der Geschichte sehen Sie einen möglichen Schaden für die Zukunft, dass die wirkliche Geschichte für die Zwecke umgeschrieben werden kann?
Es macht mir schon Bauchschmerzen. Aber ich glaube, es ist Teil unseres Berufes, die Geschichte dann richtig zu stellen und zu sagen: „Wissenschaftlich ist das falsch.“ Die Romantisierung und Idealisierung wird eine Gefahr, wenn sie zum Instrument der Politik wird. Mittelalterliche Geschichte hält aber keine Patentlösung für uns bereit, sie sagt uns nicht einfach, wie wir heute handeln sollen: Dafür ist sie zu weit weg, zu brutal, zu wenig aufgeklärt, zu undemokratisch.

Welche Schlüsse ziehen Sie als Experte über die Faszination für die Epoche des Mittelalters heute?
Zunächst einmal finde ich es großartig, wenn sich Menschen für so eine ferne Epoche interessieren. Das ist nicht selbstverständlich. Ich finde es auch großartig, wenn die Faszination in vielgestaltiger Form passiert: von Mittelaltermärkten über die Besichtigung einer mittelalterlichen Kirche oder den Besuch einer Ausstellung zum Mittelalter bis hin zu Fantasy-Literatur und Spielfilmen. Jedes Interesse an dieser fernen Zeit finde ich gut!
Gleichzeitig ist all das aber natürlich auch anders als eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dieser Epoche: Als Historiker muss ich ja leider auch auf Details und Quellenbelege achten; und es kann in unserem Fach auch sehr, sehr spezifisch und kleinteilig zugehen. Aber das macht Wissenschaft ja immer aus.
Fotos: Steffen Patzold, Campus Galli; Mirja Walther
Mehr von der Recherchegruppe Geschichtsliebe:

Von Alltagsflucht und Dudelsack
Das Mittelalter scheint in vielen Köpfen eine dunkle und rückständige Zeit gewesen zu sein. Kreuzzüge, Krankheiten, Hungersnöte – daran denken die meisten. Doch das Mittelalter hat auch viele positive Seiten. So positiv, dass sich Menschen in diese Zeit verlieben. In dieser Folge spricht Host Yannick mit Steffi. Sie und ihr Team haben zum Thema Geschichtsliebe recherchiert. Dabei sind sie auf die Band Unvermeydbar gestoßen. Die Bandmitglieder Johannes, Enii, Bene, Jonas und Timea reisen das ganze Jahr über von Mittelaltermarkt zu Mittelaltermarkt und lassen so diese Zeit wieder aufleben. Woher ihre Liebe zum Mittelalter kommt und wie historisch korrekt die Band agiert, all das hört ihr in dieser Folge.
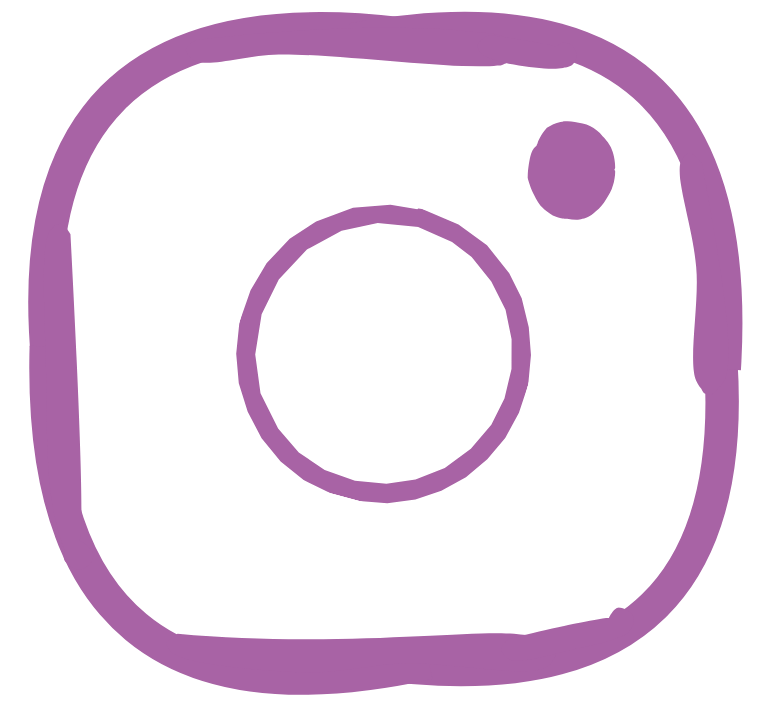
Was bringt Menschen dazu, sich in Rüstungen zu werfen, alte Instrumente zu spielen oder ganze Wochenenden auf Mittelaltermärkten zu verbringen? Für Benedikt, Alfred und viele andere ist das Mittelalter keine Flucht, sondern ein Lebensgefühl. Musik, Reiten, Gemeinschaft – jeder erlebt es anders. In diesem Beitrag erzählen sie, was sie an dieser Welt so sehr fasziniert.
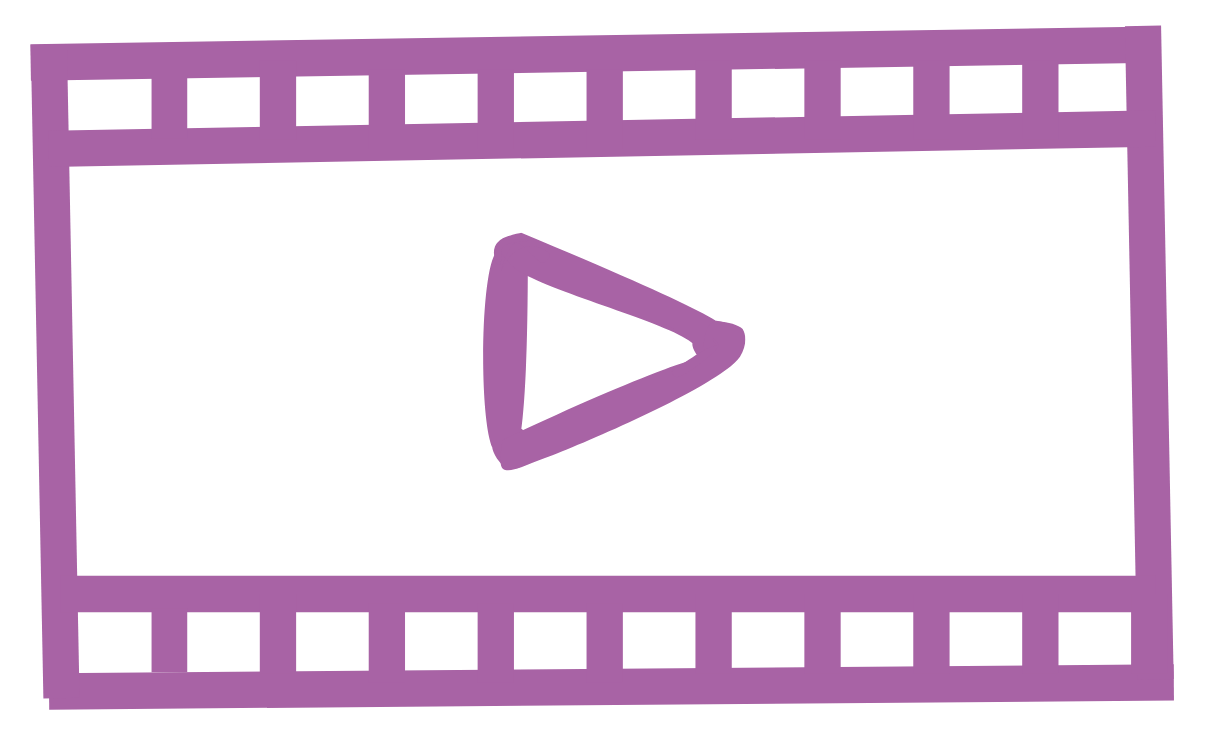
Zwischen Lanzen und Lagerleben
Was bedeutet es, Geschichte zu leben? Diese Frage haben sich unsere Reporter gestellt. Denn: Speziell Mittelaltermärkte und -feste sind deutschlandweit beliebt und gut besucht. Neben der einfachen Begeisterung für die Epoche, kommen dorthin auch Menschen, die das ganze Jahr über für die Tage trainieren: Die Hauptattraktion der Feste – Ritter der mittelalterlichen Turniere. Unter anderem mit dabei sind Ritter der „Gesellschaft der Vier Lande“ aus Frontenhausen. Es ist ein Verein aus Menschen, die das Mittelalter leben und alles dafür machen, um ihre Ritterturniere und ihr Lagerleben auf dem Mittelalterfest so authentisch wie möglich zu gestalten. Ihren Mut, Ehrgeiz und Liebe zum Mittelalter stellen sie in Arnstorf unter Beweis.
Und das sind wir:

Hier geht’s zu den Beiträgen der anderen Gruppen