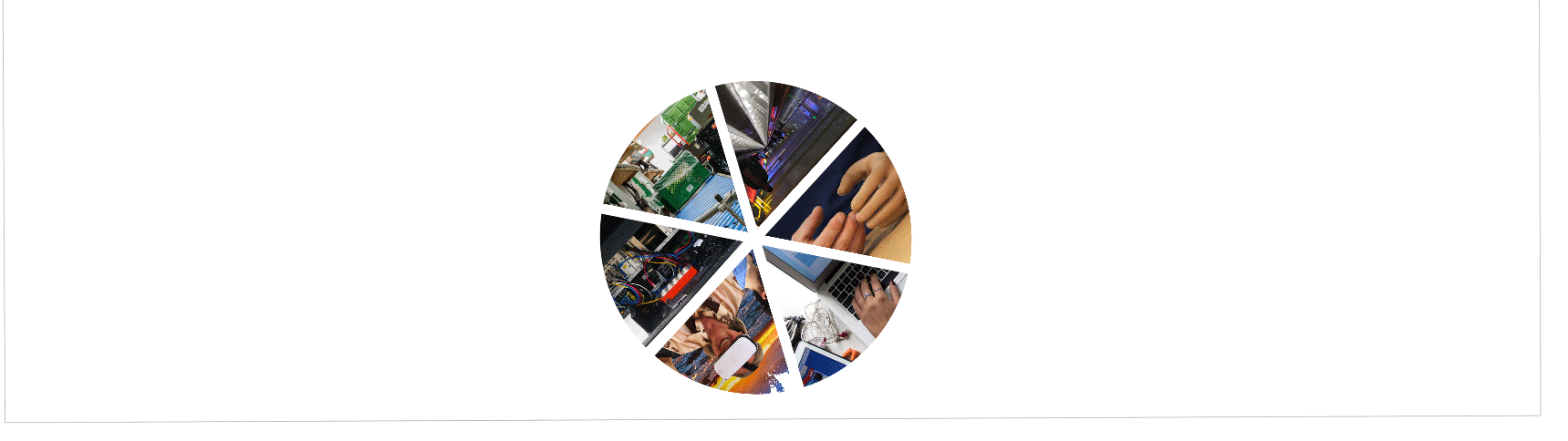Zwischen Mensch und Maschine
Was ist, wenn die Mobilität durch eine angeborene Fehlbildung oder durch einen Unfall eingeschränkt ist? Ein Einblick in die Welt der bionischen Handprothesen.27 Knochen, 36 Gelenke, 39 Muskeln und über 17.000 Rezeptoren: Die Hand ist ein Wunderwerk der Natur. Kaum ein anderes Körperteil besitzt solch ein komplexes Gerüst. Es ermöglicht uns eine ausgeprägte Feinmotorik. Doch was passiert, wenn man seine Hand verliert oder keine hat? Wer übernimmt dann ihre Aufgaben?
Für Menschen mit einer Handprothese waren lange Zeit banale Alltagsbewegungen wie Schnürsenkel binden, Geldscheine sortieren oder ein Hemd zuknöpfen undenkbar. Mittlerweile ist das anders, denn seit einigen Jahren gibt es sogenannte „bionische Prothesen“. Das Besondere daran: sie lassen sich durch Gedanken steuern. Diese Technik ermöglicht dem Träger, wieder ein fast uneingeschränktes Leben zu führen.
Menschen in Deutschland musste ein Oberschenkel, Unterschenkel oder Arm amputiert werden.
Menschen müssen sich deutschlandweit jedes Jahr einer Körperteil-Amputation unterziehen.
Was bedeutet "Bionik"?
Der Begriff „Bionik“ setzt sich zusammen aus „Biologie“ und „Technik“.
Forscher nehmen sich die Natur zum Vorbild und versuchen, biologische Prozesse und Strukturen in abstrakter Form in der Elektromechanik umzusetzen. Im Bereich der Prothetik wird versucht, mit bionischen Prothesen den menschlichen Gliedmaßen in Aufbau, Struktur und Aussehen so nahe wie möglich zu kommen.

Patrick Mayrhofer
Der Österreicher Patrick Mayrhofer verlor vor acht Jahren bei einem Starkstromunfall Teile seiner beiden Hände. Nachdem er seine linke Hand amputieren ließ und 2011 eine bionische Handprothese bekam, spezialisiert er sich nun auch beruflich auf bionische Prothesen und arbeitet beim Hersteller „OttoBock“ in Wien.
„Der menschliche Schöpfergeist kann verschiedene Erfindungen machen (…), doch nie wird ihm eine gelingen, die schöner, ökonomischer und geradliniger wäre als die der Natur, denn in ihren Erfindungen fehlt nichts und nichts ist zu viel.“
Leonardo da Vinci
Die Natur ist das Maß aller Dinge. Kein Wunder also, dass bionische Prothesen den menschlichen Körperteilen immer ähnlicher werden. So feinmotorisch wie heute waren künstliche Gliedmaße allerdings nicht schon immer. Wie sich Prothesen im Laufe der Zeit verändert haben, zeigt unser Zeitstrahl:

Ägyptische Zehprothese
Die ägyptische Zehprothese wurde circa 700 v.Chr. gefertigt und ist somit die älteste bekannte Prothese. Sie bestand aus Holz und Leder. Gefunden wurde sie am Fuß einer Mumie.



Capua-Bein
Der „Stelzfuß von Capua“ ist eine um 300 v. Chr. modellierte Beinprothese aus Bronze, die den rechten Unterschenkel ersetzte. Gefunden wurde sie vermutlich um 1885 im historischen Capua in Italien. Sie stammt noch aus der klassischen Antike.

Hand von Götz von Berlichingen
Nachdem Götz von Berlichingen 1504 während eines Krieges seine Hand verloren hatte, ließ er sich eine eiserne Ersatzhand anfertigen. Diese hatte bewegliche Finger, die mittels kleiner Zahnräder in bestimmten Stellungen fixiert werden konnten. So konnte er wieder ein Schwert halten – und weiter kämpfen.



Barbarossa Haken-Prothese
Auch vom Piraten Barbarossa ist bekannt, dass er sich 1517 seine Hand durch eine eiserne Haken-Prothese ersetzen ließ. Die Funktionen dieser Prothese waren jedoch noch sehr beschränkt: der Haken ermöglichte keine Greifmöglichkeit.

Peter Baliff- Prothese
Die Baliff-Prothese war die erste bewegliche Handprothese. Nach einer Amputation konnte die verbleibende Muskelkraft des Armstumpfes die Prothese steuern. Die um Ellenbogen und Schulter befestigten Seilzüge führten die Bewegung aus. Streckte man beispielsweise den Ellenbogen, konnte der Daumen bewegt werden. Die anderen Finger ließen sich durch eine bestimmte Bewegung des Schultergelenks strecken.



Sauerbruch-Prothese
Im Jahre 1916 nutzte Ferdinand Sauerbruch die Kraft der Bizepsmuskulatur, um die Prothese zu bewegen. In den Oberarmmuskel des Patienten legte er einen kleinen Hauttunnel, durch den ein Elfenbeinstift geschoben wurde. Spannte man den Muskel an, hob sich der Stift und löste somit eine Finger- und Handbewegung aus.

Vaduzer Hand
Auch die „Vaduzer Handprothese“ wurde durch die Muskulatur gesteuert. Es war die erste Handprothese, die durch einen elektrischen Motor angetrieben wurde. Beim Zusammenziehen der Muskeln wurde dieser aktiviert: die Hand konnte sich öffnen und wieder schließen.



Karlsruher Fluidhand
Die „Karlsruher Fluidhand“ gilt als die erste Fremdkraftprothese. Muskelbewegungen senden Signale über Elektroden an eine Minihydraulikpumpe. So wird aus kleinen Behältern Flüssigkeit in die Antriebselemente der einzelnen Fingergelenke gepumpt. Je nach Öldruck lassen sich die einzelnen Finger beugen oder strecken.

Michelangelo-Hand
Diese Hightech-Prothese wurde vom österreichischen Hersteller „OttoBock“ entwickelt. Eine Spannung, die durch Muskelbewegungen im Stumpf produziert wird, treibt kleine Motoren in der Hand an. Diese sorgen dafür, dass sich vier Finger und ein separat positionierter Daumen bewegen.



I–Limb-Ultra-Prothese
Die „I–Limb-Ultra-Prothese“ wird nicht über Muskelströme gesteuert, sondern mit dem Smartphone. Das schottische Unternehmen „Touch Bionics“ hat dafür auch eine App entwickelt, über die sich Finger und Hand bedienen lassen.

DARPA-Hand-Prothese
Im Jahre 2015 gelang es Wissenschaftlern im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erstmals, einer Prothese Gefühle zu schenken. Sie kann mit den Gedanken gesteuert werden und Tastempfindungen zurück an das Gehirn senden.
Zeichnungen: Antal Osuna

Die bionische Rekonstruktion
Für eine „bionische Rekonstruktion“ benutzt man die elektrischen Signale der Muskeln. Bei einer Operation werden die verbleibenden Muskeln im Amputationsstumpf so präpariert, dass diese Signale problemlos an die Prothese weitergeleitet werden können. Wenn der Prothesenträger an eine Bewegung denkt, kommt ein Nervensignal im Amputationsstumpf an. Dort kontrahiert dann ein Muskel. Die Kontraktion produziert eine messbare Spannung und diese wird an Elektroden, die am Stumpf befestigt sind, weitergegeben und dort in elektrische Spannung umgewandelt. So kann der Prothesenträger seine Hand steuern und mit geringer Mühe wieder Alltagsbewegungen durchführen.
Viel Zeit und Training
An eine Handprothese gewöhnt man sich aber nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit, sie als neues Körperteil zu akzeptieren. Und natürlich muss auch viel trainiert werden, um normale Alltagsbewegungen wieder intuitiv ausführen zu können.
Sogar Menschen mit einer „normalen“ Hand können bionische Prothesen steuern: EINSTEINS-Reporterin Franziska Bohn war beim Prothesenhersteller „OttoBock“ in Wien und hat einmal ausprobiert, wie das funktioniert:

Wann wird der Mensch zur Maschine?
Die technischen Innovationen, die in den letzten Jahren im Bereich der bionischen Prothetik erlangt wurden, sind immens. Doch neben den ganzen positiven Entwicklungen gibt es auch kritische Stimmen: Werden bionisch rekonstruierte Körperteile unsere biologischen irgendwann einmal vollständig ersetzen können? Sind sie vielleicht sogar leistungsfähiger? Wo sind die Grenzen?
Wir haben über dieses Thema mit Professor Oskar Aszmann, Facharzt für Plastische und Wiederherstellende Chirurgie im AKH Wien, gesprochen:
Prof. Oskar Aszmann über bionische Prothesen
Franziska Bohn
Laura Förstl
Hannah Schuster
Daphne Osuna
Das interessiert Euch bestimmt auch:
Vom Computer chauffiert: Sind autonome Fahrzeuge Gefahr oder Segen?
Bei Hunger klicken: Sterben die Supermärkte durch den Lebensmittelversand aus?